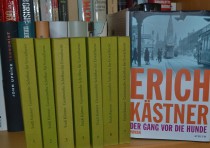Ein amerikanischer Alp-Traum
Gelungene Albee-Inszenierung im Lemgoer Bahnhof
Ein Stück absurdes Theater
WaSa. Lemgo. - Zwei Personen warten auf der Bühne, wissen aber nicht, ob und wann der Erwartete kommen wird. Der Zuschauer weiß nicht so recht, auf wen sie warten; die Frage ist, ob
die Wartenden es selber wissen. Die Wartezeit verbringen sie mit einer banalen, sinnfreien (man könnte auch sagen: absurden) Unterhaltung. Irgendwann kommen tatsächlich zwei von außen, aber ob das
die Erwarteten sind?
Alles klar? Klar! Wir befinden uns in DEM Stück des absurden Theaters.Oder? Zumindest: in einem „brillanten Beispiel“ (Esslin) für das amerikanische absurde Theater! Die Wartenden heißen
womöglich – auch wenn dies unwahrscheinlich ist –Wladimir und Estragon, werden hier aber nur Papi und Mammi genannt (und durch eine Oma ergänzt); und dass sie nicht an der Landstraße sitzen, sondern
in einem öden Wohnzimmer – nun ja, da gab’s schon ganz andere Bühnenbilder für Becketts Geniestreich. Dieses Stück ist jedoch knapp 10 Jahre jünger als „Warten auf Godot“ und stammt von Edward Albee
– jenem amerikanischen Autor, den man fast nur als Schöpfer von „Wer hat Angst vor Virginia Woolf“ kennt, was schade ist, da er eine Reihe weiterer Stücke geschrieben hat, die den amerikanischen
(Alb-)Traum im Allgemeinen und die daraus resultierende Ehehölle im Besonderen spektakulär auf die Bühne bringen.
Umso verdienstvoller ist es, dass das kleine engagierte Lemgoer Privattheater „Stattgespräch“ – nach der „Zoogeschichte“ vor gut 10 Jahren – ihr Publikum nunmehr mit einem zweiten der frühen
Albee-Einakter konfrontiert.
Im „amerikanischen Traum“ wartet also ein wohlsituiertes mittelaltes Mittelstandspaar, in dem Albee nebenbei bemerkt seine Adoptiv(!)-Eltern boshaft karikiert hat. Man darf vermuten: sie warten auf
den Handwerkerservice der Wohnungsgesellschaft, der den Kühlschrank, die Türklingel und vor allem das zimperlich-verschämt nur als „Örtchen“ (im amerikanischen Original: „Johnny“) bezeichnete Klo
reparieren soll. In der Zwischenzeit textet sie ihn zu. Highlight der einseitigen Unterhaltung: ihr Bericht über den Kauf eines Hutes und die Probleme der Farbwahl. Ihn interessiert das alles nicht;
er hat aber gut trainiert, ihre Kontrollfragen, ob er denn auch zuhöre, mechanisch-korrekt zu beantworten. Gewürzt wird die Unterhaltung durch die Oma, die sich sich über schlechte Behandlung beklagt
und zwischendurch dem Schwiegersohn und vor allem der Tochter in durchaus deftiger Wortwahl die Meinung geigt.
Irgendwann kommt dann tatsächlich Frau Barker. Aber ob sie die Erwartete ist? Sie wurde zwar (vermutlich) telefonisch angefordert, ist aber garantiert nicht gekommen, um das Klo zu reparieren. Warum
sonst – sie weiß es selber nicht, und das Ehepaar weigert sich, es ihr zu sagen. Erst die Oma gibt ihr später einen Hinweis, und der geht ungefähr so: (vermutlich) Frau Barker hat (vermutlich)
unserem Ehepaar vor Jahren ein Adoptivkind vermittelt; das Glück war groß, schwand aber schnell, als sich herausstellte, dass so ein Baby auch Probleme machen kann; das Paar wusste sich zu helfen:
alles was störte, wurde ausgemerzt: die Augen ausgekratzt, den Penis abgeschnitten, die Hände abgehackt, die Zunge herausgeschnitten ... so lange, bis das teuer bezahlte Kind so fies war, einfach zu
sterben. Und jetzt wollen die (vermutlichen) Adoptiveltern von der (vermutlichen) Adoptivvermittlerin (vermutlich) das Geld zurück. Aber womöglich ist auch alles ganz anders ...
Immerhin trifft es sich gut, dass nun ein junger Mann auf Arbeitssuche auftaucht. Und dem wurde (angeblich) sein Zwillingsbruder, sein anderes Ich weggenommen, und damit hat er selbst wesentliche
menschliche Eigenschaften und Fähigkeiten verloren – und zwar etwa parallel zu den Verstümmelungen des Adoptivkindes. Deshalb mag der Zuschauer vermuten – auch wenn die statistische
Wahrscheinlichkeit dafür nahe Null liegt – dass dieses Adoptivkind der Zwillingsbruder war. Aber vielleicht / wahrscheinlich war auch alles ganz anders …
Jedenfalls deichselt die Oma, dass der Neuankömmling das verlorene Adoptivkind ersetzt, was die Adoptiveltern insofern begeistern kann, als es sich bei dem Jungen um einen (den?) „amerikanischen
Traum“ handelt: einen attraktiven Bodybuilder-Typ: „gutgeschnittenes Gesicht, gerade Nase, ehrliche Augen, wunderbares Lächeln: der Typ des geradezu unverschämt gut-aussehenden Farmerjungen“ (so die
bescheidene Selbstbeschreibung) - heute würde man den bei „Baywatch“ verorten; Anfang der 60er Jahre war er für die Oma der geborene Filmschauspieler.
Happy End also, wie es sich für eine ordentliche Komödie gehört. Aber ist das wirklich eine Komödie? Sie ist etwa so komisch wie Wilhelm Buschs Geschichten von den kleingehäckselten Lausbuben oder
der im Suff verkokelnden frommen Helene. Denn der „amerikanische Traum“ mag äußerlich perfekt sein – aber auf den zweiten Blick doch voller Mängel: zwar ist der arbeitssuchende junge Mann bereit
„fast alles zu tun ... soweit’s Geld bringt“ – hat aber „keinerlei Fähigkeiten“ und sieht sich selbst als „unvollständig“: die Verluste, die er parallel zu seinem (eventuellen) Zwilling erlitten hat,
machen ihn blind für die Probleme anderer, liebesunfähig, gefühlsunfähig ...
Absurd oder realistisch?
Wahrlich eine prophetische Darstellung! Man muss sich klar machen, dass dieses Stück 1961 erschienen ist – zu einer Zeit also, als der Glaube an den „amerikanischen Traum“ noch ungebrochen war,
welcher im (amerikanischen) Wikipedia bis heute ungefähr so definiert wird:
Der Amerikanische Traum ist das nationale Selbstverständnis der USA: ein Ensemble von Idealen, wo Freiheit die Chance für Wohlstand und Erfolg mit sich bringt, wo sozialer Aufstieg nicht von der
Herkunft abhängt sondern von eigener Anstrengung.
Pünktlich zur Lemgoer Premiere des „amerikanischen Traums“ veröffentlicht der SPIEGEL ein Gespräch mit dem New Yorker Wirtschaft-Nobelpreisträger Joseph Stiglitz (anlässlich der deutschen Ausgabe des
Buchs „Der Preis der Ungleichheit“). Hier prangert der Autor die „Spaltung der (amerikanischen) Gesellschaft“ in ganz Arme und ganz Reiche an und betont:
„der amerikanische Traum ist ein Märchen geworden. Die Chancen eines jungen US-Bürgers hängen stärker vom Einkommen und von der Ausbildung seiner Eltern ab als in jedem anderen Industrieland ... Der
Glaube an den amerikanischen Traum wird von Anekdoten getragen, von wenigen Beispielen für den Aufstieg von ganz unten.“
Insofern zeichnet das – angeblich „absurde“ – Stück von 1961 ein realistisches Bild von heute und bestätigt damit Albees These:
„Da das absurde Theater die bestehenden Lebensbedingungen nachzeichnet, ist es das realistische Theater, während das angeblich realistische Theater, das ein falsches Bild von der Realität gibt, das
eigentlich absurde Theater ist.“
Gelungene Lemgoer Inszenierung:
Dieses Stück absurder Realität wird von der Lemgoer freien Theatergruppe „Stattgespräch“ mit der Sorgfalt und dem Ideenreichtum auf die Bühne gebracht, wie man sie von diesen Amateuren (was im
eigentlichen Wortsinn gemeint ist: Liebhabern) gewohnt ist. Auffällig ist vor allem die Liebe zum Detail, mit welcher der Prinzipal dieser engagierten Truppe, Frank Wiemann, nicht nur Regie führt
sondern auch das Bühnenbild gestaltet: ein 60er-Jahre-Wohnzimmer von geradezu bezaubernder gutbürgerlicher Hässlichkeit. Da fehlt weder die Topfblume noch das Hochzeitsfoto auf der Musiktruhe, weder
die plumpe Polstergarnitur noch der Ölschinken mit Sonnenuntergang über gischtenden Brandung. Die Flinte hinterm Schrank übersieht man zunächst; ebenso die liebevoll eingerichtete Spielecke ...
zumindest letztere wird aber noch an Bedeutung gewinnen. Vielsagend-vorausdeutend auch der kleine Prolog, den Wiemann seiner Inszenierung voranstellt: ein Theatergeist schleicht über die Bühne und
konfrontiert das Ehepaar mit einer Marionette (vielleicht eine Reminiszenz an Siegfried Kienzles Kurz-Interpretation, wonach sich der genormte amerikanische Lebenstraum in den Marionetten einer
Durchschnittsfamilie erschöpfe) – bezeichnend aber, dass es sich bei dieser Puppe um einen langnasigen Pinocchio handelt!
Irgendwo im Stück ist mal von einer flackernden Lampe die Rede; in Lemgo wird daraus fast so etwas wie ein Running Gag: neben (unter) der Wohnung fährt alle paar Minuten eine U-Bahn entlang, und
jedesmal flackert dann das Licht – wer will, mag das als Hinweis auf die verrottete öffentliche Infrastruktur im reichsten Land der Erde nehmen. – Fragwürdig dagegen, wenn in der Lemgoer Inszenierung
plötzlich eine heftige Schießerei zu hören ist. Man vermutet zwei Gangsterbanden, die sich vor der Tür bekämpfen. Oder sollte sich Amerika im Krieg befinden? Das eine wie das andere wäre in dieser
kurzen, isolierten Szene arg aufgesetzt und ohne jeglichen Bezug (im Stücktext kommt zwar mal das Wort Luftangriff vor, aber in einem so nebensächlichen Zusammenhang, dass es ein derartiges Spektakel
keinesfalls rechtfertigt).
Zu loben wiederum die Personenführung, die den Darstellern Gelegenheit zum so richtig aufspielen gibt. Allen voran Liane Kreye als boshafte Oma (mit herrlichen kleinen Gesten, wenn sie beispielsweise
ihrem Schwiegersohn so en passant die Schachfiguren vertauscht), aber auch Sven Meyer und Doris Weiß als wunderbares Spießer-Ehepaar (sie strickt in den amerikanischen Nationalfarben) und schließlich
Claudia Hülsemann-Stenten als die gelungene Verkörperung der Frauenvereins-Präsidentin (auch so eine Ikone amerikanischer Gutbürgerlichkeit), die zudem – wie sie so den Großteils des Abends in ihren
Dessous auf der Bühne steht – zum erotischen Traumbild (nicht nur) des verklemmt-prüden amerikanischen Mannes wird.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Der amerikanische Traum
Absurde schwarze Komödie von Edward Albee
Regie und Bühnenbild: Frank Wiemann
Mommy: Doris Weiß
Daddy: Sven Meyer
Grandma: Liane Kreye
Mrs. Barker: Claudia Hülsemann-Stenten
Young Man: Ben Berger