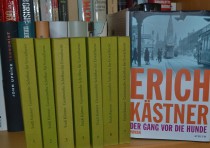„Utopia“ und andere Utopien
Ein seltsames Zusammentreffen
g.WaSa - Kürzlich, in der Premiere von „Mammon zieht blank“ am Landestheater Detmold, trat neben anderen historischen Figuren auch Thomas Morus auf – obwohl er dort eigentlich nicht viel zu suchen, zumindest nichts Substanzielles zu sagen hatte. Kurz darauf wurde in der Detmolder Christuskirche eine Ausstellung eröffnet, die nach dem bekanntesten Werk eben dieses Thomas Morus benannt ist: „Utopie – ohne Ort“. Und wiederum wenige Tage später stoße ich – auf der Suche nach etwas völlig anderem – in einem abgelegenen Winkel meiner Bibliothek auf ein Buch, das ich vor fast 40 Jahren gekauft, aber seit vermutlich 30 Jahren nicht mehr aufgeschlagen habe: „Der utopische Staat“, ein Sammelband, der an erster Stelle „Utopia“ von Thomas Morus enthält (außerdem den „Sonnenstaat“ und „Neu-Atlantis“; s.u.).
Auch wenn ich ein solches Zusammentreffen keineswegs für etwas wie einen „Wink des Schicksals“ betrachte (die Wahrscheinlichkeit dafür ist zwar gering, liegt aber immerhin im Bereich des Möglichen – so ähnlich wie ein „6er“ im Lotto extrem unwahrscheinlich ist, aber dennoch fast allwöchentlich Realität wird) – es war mir doch Anlass genug, den 500 Jahre alten Schinken mal wieder zu lesen.
Und schließlich provoziert die aktuelle Berichterstattung in mir die Frage, ob unsere heutige Politik nicht allzusehr unter dem Mangel an Utopien leidet.
„Utopia“: Namensgeber für eine ganze Gattung
Morus wollte mit seinem „Utopia“ einen „idealen Staat“ beschreiben und seinen Zeitgenossen als Vorbild hinstellen. Der volle Titel lautet denn auch: „Vom besten Zustand des Staates oder von der neuen Insel Utopia (De optimo statu rei publicae deque nova insula Utopia)“. Das war nicht unbedingt etwas Neues – ähnliche Versuche gab es seit Menschengedenken (siehe unten: Vorläufer); und nach „Utopia“ ging es erst richtig los: inzwischen lassen sich ganze Bibliotheken mit „Utopien“ füllen (s. „Folgen“). – Mit „Utopien“, ja. Denn Morus‘ Werk wurde zum Namensgeber für eine ganze riesige Gattung von Literatur, Romanen vor allem, später dann auch für Filme, TV-Serien und (Computer-) Spiele ...
Dabei hatte der (selbstverständlich „humanistisch gebildete“) Renaissancegelehrte einfach einen griechischen Begriff geschaffen: aus den Wörtern „οὐ“ und „τόπος“, in unserer Schreibweise: „ou“ (=„nicht“) und „tópos“ (=“Ort“). Also: „Nicht-Ort, Ort, den es nicht gibt“. Um es vorwegzunehmen: Da mit Utopien in der Regel positive, anzustrebende Zustände beschrieben werden, traf es sich gut, dass „Ou-tópos“ im Englischen gleich ausgesprochen wird wie „Eu-tópos“, was sich mit „guter Ort“ übersetzen lässt. Die später folgenden zahllosen „negativen Utopien“ (s.u.) werden von Fachleuten dementsprechend gerne als „Dys-tópos“, als „Dystopie“ bezeichnet: als „schlechter Ort“.
Vorläufer: das „Goldene Zeitalter“
So weit zurück es Zeugnisse für die geistige Entwicklung des Menschen gibt, so weit zurück gibt es Hinweise auf eine ewige Sehnsucht des Menschen nach einem besseren Leben, nach einem idealen Lebensraum, nach einem „Goldenen Zeitalter“, in dem die Menschen in Harmonie mit ihresgleichen und mit ihrer Umwelt leben, ohne einen alltäglichen Kampf ums Dasein führen zu müssen. Zunächst wurde dieses ideale Welt in eine ferne Vergangenheit verlegt, eine „gute alte Zeit“, in der sich die Welt noch in einem „unschuldigen“ Ur- und Naturzustand befand. Dabei bestand die Hoffnung, dieses Goldene Zeitalter würde wiederkehren – in der indischen Kosmologie beispielsweise im Glauben an einen ewigen Kreislauf, in dem vier Weltzeitalter („Yugas“) zyklisch aufeinander folgen.
Nicht viel anderes ist der christliche (und davon abgeleitete moslemische) Glaube an einen verlorenen Garten Eden und die Hoffnung, nach dem Tode wieder „ins Paradies einzugehen“.
Die Utopie: Aufforderung zum aktiven Handeln
Thomas Morus‘ „Utopia“ unterscheidet sich grundlegend von derartigen Wunschbildern, die sich ein ideales Leben aufgrund kosmischer Kreisläufe oder durch eine himmlische Gnade (nach gottgefälligem) Leben erhoffen. Dagegen beschreibt Morus eine (natürlich fiktive, aber angeblich reale oder doch mögliche) Insel in einem fernen Meer, auf der ein ideales Zusammenleben bereits im Diesseits möglich ist. Und erreichbar wäre dieses Ideal auch für seine Ansprechpartner und Leser, zunächst also seine englischen Landsleute, die sich die Erfahrungen der Utopier zunutzen machen und durch Reformen ähnlich günstige Bedingungen schaffen könnten. Letzten Endes soll „Utopia“ der herrschenden Klasse als Vorbild dienen, nach dem sie ihre Staats-, ihre Regierungsgeschäfte ausrichten sollten. „Utopia“ ist also – wie auch Campanellas „Sonnenstaat“ und Bacons „Neu-Atlantis“ - ein sogenannter „Staatsroman“, der letztlich auf Platons „Staat“ zurückweist („Πολιτεία“ = „Politeía“; um 400 v.Chr.), in dem sieben antike Denker (darunter Sokrates) über die Ausgestaltung eines „idealen Staates“ diskutieren.
Das Buch
Auch in der äußeren Form seiner Schrift folgt Morus dem Beispiel Platons: Auch Utopia ist als Gespräch konzipiert: zwischen dem realen Verfasser, dem englischen Diplomaten Morus, und dem fiktiven weltreisenden Philosophen Raphael Hythlodeus (von manchen mit „Feind dummen Geschwätzes“ übersetzt), der von seinem Aufenthalt auf der bislang unbekannten Insel Utopia berichtet. Diese Konstruktion gibt dem Verfasser (immerhin ja ein prominenter Vertreter der herrschenden Klasse) die Möglichkeit, die Begeisterung Hythlodeus‘ über das völlig andere gesellschaftliche und politische System immer wieder zu dämpfen und ihm zu widersprechen.
Natürlich ist die Entwicklung seit dem Erscheinungsjahr 1516 so weit vorangeschritten, dass, was für einen damaligen aufgeklärten, fortschrittlichen Denker als „ideal“ galt, heute entweder längst verwirklicht ist, oder oft auch schon wieder als überholt und rückschrittlich gelten muss. Bemerkenswert ist etwa die religiöse Toleranz der Utopier – in Europa wurden für Ketzer damals noch Scheiterhaufen errichtet. Auch ihre Sklaven behandelten die Utopier ausgesprochen „human“ – an der Institution der Sklaverei gab es indessen keinen Zweifel (die wurde in England erst 1834 gesetzlich verboten). Und wenn es für den frommen Katholiken Morus eine unmoralische Skurrilität war, dass Ehekandidaten sich vor der Hochzeit nackt sehen durften, um nicht „die Katze im Sack zu kaufen“, so scheint heute allenfalls noch skurril, dass diese Musterung unter der gewissenhaften Aufsicht „einer würdigen und ehrbaren Hausfrau“ und eines „rechtschaffenen Mannes“ zu erfolgen hatte (S. 82).
Manche Errungenschaften der Utopier gelten uns nach wie vor für utopisch:
„Gesetze haben sie sehr wenige ... Ja, sie mißbilligen an anderen Völkern vor allem, daß man dort selbst mit zahllosen Bänden von Gesetzen und Gesetzesauslegungen nicht auskommt“ (85)
Und: Die grundlegenden Unterschiede zwischen Utopia und der (damals) bekannten Welt gelten bis heute fort – und natürlich musste schon damals der englische Staatsmann Morus Kritik üben
„... an dem, was die eigentliche Grundlage ihrer ganzen Verfassung bildet, nämlich an ihrem gemeinschaftlichen [kommunistischen] Leben uind der Lebensweise ohne jeden Geldumlauf“ (109)
Hier ist bereits die Marx’sche Forderung verwirklicht: „Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen”: der Staat sorgt für Deckung der Bedürfnisse und alle (Frauen wie Männer) tragen dazu bei, die dafür notwendigen Güter zu erzeugen. Da auf unnötigen Luxus verzichtet wird und da es vor allem keine parasitischen Ausbeuter gibt, die einen unangemessen hohen Anteil der Produktion für sich abzweigen, genügt eine tägliche Arbeitszeit von sechs Stunden, um alle gut zu versorgen (zur Erinnerung: noch im England des 19. Jahrhunderts galt ein 12-Stunden-Tag). Interessanterweise kam der österreichische Sozialreformer Joseph Popper-Lynkeus aufgrund detaillierter Berechnungen 1912 zu dem Ergebnis, eine angemessene Versorgung lasse sich mit einem Normalarbeitstag von sechs Stunden gewährleisten.
Wir Angehörige einer „Wir amüsieren und zu Tode“-Gesellschaft fragen uns allerdings, was die Utopier wohl mit ihrer vielen Freizeit angefangen haben, von Familienleben und Fortbildung einmal abgesehen. Schon kurze Reisen über Land waren nicht gern gesehen und bedurften der Erlaubnis; Urlaub in fremden Ländern war unvorstellbar; natürlich waren ordinäre Karten- und Würfelspiele verpönt; allenfalls einige wenige Spiele waren üblich, die nur vage beschrieben werden, heutzutage aber sicherlich das Prädikat „pädagogisch wertvoll“ tragen würden. Auch mit der Kultur schien es nicht weit her gewesen zu sein; einzig die Musik wird ein paar mal erwähnt. Von einer eigenen Literatur ist nicht weiter die Rede – vielmehr haben erst die abendländischen Besucher die Papierherstellung und den Buchdruck mitgebracht, ebenso wie die griechischen Schriftsteller (von Homer über Plato und Aristoteles bis zu Sophokles und Herodot; aber schon „die Lateiner“ waren wohl allzu profan; S. 78 f.). Und bildende Kunst? – Fehlanzeige, mal abgesehen von Denkmälern für verdiente Volksgenossen (so viel zu allgemeinen Gleichheit).
Immerhin ist den Utopiern ist die Schaffung des „neuen Menschen“ gelungen, an der später (nicht nur) die Sowjetunion so spektakulär gescheitert ist: eines Menschen also, der – obwohl er seine Bedürfnisse erfüllt bekommt und es darüber hinaus keinerlei materielle Anreize gibt – brav und fleißig seine Aufgaben erfüllt und sein Scherflein zum Wohl der Allgemeinheit beiträgt. Denn Privateigentum gibt es so gut wie nicht, selbst die Wohnungen werden regelmäßig neu verlost. Geld braucht man nicht – es existiert daher auch nicht. Was man allerdings durch Außenhandelsüberschüsse verdient, an Tributen der Kolonien (ja, auch die gibts noch) einnimmt, wird gespart: für den Fall eines Krieges. Denn wenn Utopia auch – selbstredend! – eine friedfertige Insel ist, so galt doch schon damals Schillers Erkenntnis, dass auch der Frömmste nicht in Frieden leben kann, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Droht nun also Krieg, wird dieser vorzugsweise mit Hilfe des angehäuften Goldschatzes anstatt mit dem Blut der Utopier gewonnen: am liebsten, indem man einen Putsch der Opposition gegen die kriegslüsterne gegnerische Regierung finanziert (soviel zum Thema Demokratie), oder indem man fremde Söldner dafür bezahlt, dass sie ihr Leben für die Utopier riskieren. (Solange es nicht gebraucht wird, wird das gehortete Gold übrigens für Produkte wie Kloschüsseln verwendet, die dann im Ernstfall leicht gegen solche aus profaneren Materialien getauscht werden können).
Insgesamt ist diese Bescheibung genau das, was später Max Horkheimer als das Wesen der Utopie bezeichnen wird: „die Kritik dessen, was ist, und die Darstellung dessen, was sein soll“. Und Morus beschränkt sich nicht darauf, diese Kritik in der Erzählung von einer fernen Insel Utopia zu verstecken. In einem (später eingefügten) ersten Teil lässt er seinen klugen Weltreisenden Raphael begründen, warum es zwecklos sei, einem Herrscher einen Philosophen als Berater zur Seite zu stellen – und dabei legt Morus seinem Protagonisten jede Menge direkte Kritik an der englischen Politik und Gesellschaft in den Mund – eine erstaunliche Leistung für einen Autor vom Stand und Range eines Thomas Morus!
Der Autor
Thomas Morus, geboren 1478 in London als Sohn eines Richters, genoss eine gute Ausbildung, stand dann vor der Wahl zwischen unterschiedlichen Karrieren: als Literat, als Akademiker, als Jurist – und wurde schließlich Politiker: 1504 Member of Parliament, 1523 Speaker (=Parlamentssprecher); schon vorher war er Diplomat in Diensten Heinrichs VIII., Mitglied des Geheimen Rates des Königs, 1529 auch Lordkanzler. Zum Verhängnis wurde ihm der Streit Heinrichs VIII. mit Papst Clemens VII. um die Anunullierung von Heinrichs Ehe mit Katharina von Aragón, was letztlich zur Gründung der anglikanischen Kirche führte. Weil Morus sich weigerte, diese Kirchenspaltung mitzumachen und dem Papst bzw. dem katholischen Glauben treu blieb, wurde er 1535 hingerichtet, sein Kopf einen Monat lang auf der London Bridge zur Schau gestellt. Die katholische Kirche ehrt ihn als Märtyrer.
Die Nachfolger: mehr Dystopien als Utopien
Die wichtigsten „klassischen“ utopischen Romane nach „Utopia“ (1516) waren: „La città del Sole – der Sonnenstaat“ des italienischen Dominikanermönchs Tommaso Campanella, 1602 verfasst und 1623 erschienen; sowie das unvollendet gebliebene „Nova Atlantis – Neu-Atlantis“ des englischen Philosophen, Wissenschaftlers und Staatsmanns Francis Bacon, veröffentlicht 1627, ein Jahr nach dem Tod des Verfassers. Von zahlreiche späteren Büchern dieser Gattung sind weniger die Gesellschaftsutopien in Erinnerung geblieben, als die technischen Utopien, angefangen von der Science Fiction eines Jules Vernes (Reise zum Mond und um den Mond, 1865/69, oder die Romane um Kapitän Nemo und sein U-Boot Nautilus, 1869/1875).
Bei der literarischen Gestaltung alternativer Gesellschaften dominiert dagegen die sog. Dystopie, die „negative Utopie“ – mit den beiden „Klassikern“ aus dem 20. Jahrhundert: Aldous Huxleys „Brave New World / Schöne neue Welt“ (1932) und George Orwells „1984“ (1949); auch Franz Kafkas Bürokraten-Alpträume rechnen manche dazu („Der Process“, 1915) oder Ernst Jüngers „Auf den Marmorklippen“ (1939). Jüngere Beispiele von dystopischen Romanen sind etwa:
- Margaret Atwoods „The Handmaid's Tale / Der Report der Magd“ als Warnung vor einem religiös-fundamentalistischen Totalitarismus (1985),
- die Warnungen Gudrun Pausewangs vor Atomkrieg, Atom-GAU oder Faschismus,
- Suzanne Collins‘ „Tribute von Panem“ (2009),
- Dave Eggers “Circle” (2014) über die (nur noch wenig aus der Gegenwart fortgeschriebene) unheilvolle Macht der “sozialen Netzwerke”; und schließlich
- Michel Houellebecqs “Soumission / Unterwerfung” (2015)
Aus der Unzahl dystopischer Filme sei nur “The Day After Tomorrow“ (2004) genannt.
Demgegenüber haben optimistische Utopien Seltenheitswert. Neben Hermann Hesses „Glasperlenspiel“ (1946), das ich hier nur mit großen Vorbehalten nenne, fällt mir vor allem Ernest Callenbachs „Ökotopia“ (1975) ein: die Vision einer ökologischen Republik im Nordwesten der USA.
Man mag sich streiten, worin der Grund für das Übergewicht der Dystopien über die Utopien liegt: Ist die reale Welt tatsächlich so schlecht und eignet sich deshalb besser zum Modell einer negativen als einer positiven Darstellung? Oder liegt es daran, dass der Roman nun mal vorzugsweise die Auseinandersetzung eines Helden mit seiner Umwelt zum Thema hat, dass demzufolge – je positiver der Held gestaltet wird – die (gegnerische) Umwelt um so negativer gezeichnet werden muss?