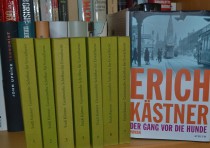Utopia in der Leer.Raum.Kirche?
Bedauerlicher Mangel an Utopien ...
... in unserer Gesellschaft und auch in der Detmolder Christuskirche
g.WaSa - Eine Utopie ist „die Darstellung dessen, was sein soll“ und damit „die Kritik dessen, was ist“ – so hat es Max Horkheimer ausgedrückt und damit ziemlich genau beschrieben, was Thomas Morus mit seinem Roman „Utopia“ beabsichtigt hatte, der für ein ganzes Genre namensgebend werden sollte. Und für Ernst Bloch, den Philosophen des „Prinzip Hoffnung“ bedeutete Utopie „Denken nach Vorn“, ein Denken (oder auch: „Träumen“), das einer „bewußt gestaltenden, umgestaltenden Phantasie“ bedarf. Wenn eine erträumte ideale Gesellschaft „Nicht“ ist, so ist die Utopie „Noch Nicht“ und es ist Aufgabe von uns Zeitgenossen, sie zur existierenden Gegenwart zu machen.
Angesichts zahlloser drängender Probleme unserer Gegenwart wären uns Utopien – zumal im Bloch’schen Sinne, mit dem Willen zur aktiven Gestaltung! – dringend vonnöten. Doch ein Vorschlag, der in der politischen Diskussion als „utopisch“ bezeichnet wird, hat schon verloren. Das Verhältnis unserer Kanzler der letzten 30 Jahre oszilliert zwischen Helmut Schmidts „Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen“ über das diskussionsabwürgende „Basta“ Schröders bis zur „alternativlosen“ Durchwurstelpolitik Angela Merkels. Weniger Utopie war nie!
Unter diesen Umständen ist es höchst verdienstvoll, dass die Evangelische Kirche in Lippe „Künstlerinnen und Künstler eingeladen (hat) ein Werkstück für eine Ausstellung unter dem Titel ‚Utopie – ohne Ort‘ zu gestalten“. (Ein Titel, der übrigens einen simplen Pleonasmus darstellt, denn der Erfinder der „Utopie“ hat diesen Begriff einfach zusammengesetz aus den griechischen Wörtern „οὐ“ und „τόπος“, in unserer Schreibweise: „ou“ = „nicht“ und „tópos“ = “Ort“. Also: „Nicht-Ort, Ort, den es nicht gibt“.)
Bis zum 30. Juni 2015 ist die Ausstellung noch in der Christuskirche am Detmolder Kaiser-Wilhelm-Platz zu sehen. Täglich von 10:00 – 17:00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Jeweils von 12:00 – 15:00 Uhr ist eine/r der Künstler/innen vor Ort (mehr).
Schade nur, dass man versucht ist, das Lob für diese Themenwahl sofort wieder zurückzunehmen, wenn man liest, wie Pfarrer Maik Fleck in seiner Einführung die Utopien in eine ganz üble Ecke stellt: „Wenn Utopien verwirklicht werden, hat es in der Regel zu unmenschlichen Zuständen geführt. Diktatur ist eine Form verwirklichter Utopie“. Und das als evangelischer Pfarrer! Ein Jahr nach Erscheinen von Thomas Morus‘ „Utopia“ hat Martin Luther seine Thesen an die Wittenberger Kirche genagelt. Wenn es heute neben der traditionsverhafteten katholischen Kirche auch eine liberalere, aufgeschlossenere christliche Glaubensgemeinschaft gibt, so ist das die ein Stück weit verwirklichte Utopie von einer besseren Kirche, die der Mönch aus Eisleben im frühen 16. Jahrhundert erträumt hat. Immerhin verweist Fleck auch auf „biblische Bezüge“ zum Begriff der Utopie: „das gelobte Land“ und „die himmlische und die irdische Stadt Jerusalem“ – bemerkenswert, da Kirchenvertreter es in der Regel ablehnen, die biblischen Verheißungen als „Utopien“ einzuordnen!
Und schließlich gibts noch eine abschließende Bemerkung Flecks – und auf die sollten wir uns, so meine Empfehlung, konzentrieren:
„Utopien, wo sie gedacht, geliebt und gelebt werden, halten den Horizont offen und entlarven die Rede von der Alternativlosigkeit als Lüge.“ – Ja! Genau!
Ich weiß nicht, inwieweit diese Widersprüchlichkeit auf Seiten der Einladenden dazu geführt hat, dass die eingeladenen Künstler offensichtlich nicht so recht etwas mit dem vorgegebenen Thema „Utopie – ohne Ort“ anzufangen wussten.
Die direkteste Umsetzung des Themas stammt von Günter Schulz (*1939): Er hat einfach die Buchstaben „UTOPIA“ aus Goldfolie ausgeschnitten und neu zusammengefügt zu einer beinahe symmetrischen Graphik in einer kargen, strengen Schwarz-Gold-Optik. Das wirkt so selbstverständlich, dass ich es auf den ersten Blick ignoriert, für ein liturgisches Zeichen und damit als ein Teil der „normalen“ Kirchenausstattung angesehen habe (merkt man daran meine katholischen Wurzeln?)..
Die meisten Beteiligten haben ihre Beiträge nach dem „Standardrezept mit Varianten“ der gegenwärtigen Malereikunst erstellt:
Ich liebe (je nach Variante:) kräftige / zarte Farben, die ich auf Papier / Landwand konfrontiere / harmonisch anordne, so dass sie ineinander zerfließen / sich in klaren geometrischen Formen voneinander absetzen und dass am Ende etwas gegenständlich Vorstellbares / reine Abstraktion dabei herauskommt ...
Je nach Kreativität denkt man sich dann noch einen Titel aus, der zum Bild passt oder zur Aufgabenstellung, im Idealfall zu beiden.
Das ist beispielsweise Evelyn Vogt (* 1952) beinahe perfekt gelungen: Ihr Werk „Utopie – die eigene kleine heile Welt“ zeigt drei kleine Figuren in einer dramatischen Landschaft: im oberen Drittel dräuen grell- bis düster-violette Gewitterwolken. Darunter eine vage Landschaft, deren grün-graue Farbe „Kahlheit“, „Kargheit“ assoziieren lässt; ein paar einsame dunkle Striche erinnern an trockene oder bereits umgestürzte Bäume ... Nur da, wo die drei Gestalten stehen, könnte das satte Grün gepflegten Rasen oder womöglich gar fruchtbares Feld bedeuten – ist das die „eigene kleine heile Welt“ in einem bedrohlichen Umfeld? Aber genau da branden sturmgepeitschte fast schon schwarzblaue Wogen gegen die verletzliche Küstenlinie. - Unter „Utopie“ stelle ich mir anderes vor. Doch diesen Schönheitsfehler verzeiht man angesichts der Anschaulichkeit und farbenkräftigen Dynamik dieser Komposition. – Apropos Dynamik: gerade über den Köpfen der drei Figuren löst sich das düstere Violett der Gewitterwolke in ein helles, fast schon freundlich anmutendes Gelb auf. Sollte da in Kürze die Sonne heraus kommen?
Einfacher nachzuvollziehen ist die Utopie-Vorstellung von Vera Kunas (* 1961): ein in naiv-realistischem Stil gemaltes „Paradies“ (so auch der Titel): „ein Fluss mit frischem Wasser“, eine üppige Vegation mit reichlich essbaren Früchten; bunte Fische, Schmetterlinge und Echsen ...: der Garten Eden, die Ur-Utopie der drei großen vorderasiatischen Religionen. Allerdings ist das nicht die Bloch’sche Utopie, die sich der Mensch erarbeiten muss. Und sich erarbeiten kann! Das Paradies dagegen ist das unbekannte „Land, nach dem ich mich so sehne“, zu dem man nur durch einen himmlischen Gnadenakt Zugang erhält, wo man sich allenfalls hineinträumen kann: als angedeutet-gestrichelte Eva, als vage-transparenter Adam.
Andere versuchen, wenigstens selbst einen Bezug zum Thema „Utopie“ in ihr Werk hineinzuinterpretieren. Irene Schramm-Biermann (* 1950) etwa, die ihre „Irreale Landschaft 1“ aus verschiedenfarbigen und –formigen Vierecken zusammengebaut hat (eine kleine Mondsichel lässt noch ein bisschen nächtliche Realität erahnen) und dazu geschrieben hat:
„Unsere Erfahrungen deuten darauf hin, dass zumindest das menschliche Gehirn die Fähigkeit hat, sich aus der Realität zu entfernen ... und so aufzubrechen in andere Welten, Utopien zu denken. Kunst eröffnet Möglichkeiten, dies darzustellen“.
Ein boshafter Betrachter würde vielleicht fragen: ‚Warum hast du dann diese Möglichkeiten nicht genutzt?‘
Noch verschwurbelter, immerhin mit einem Hauch Gesellschaftskritik, ist Nicole Drudes (*1972) Begleittext:
„Der Fotokopierer vervielfältigt Inhalte in sinnlicher Weise [aha!], sie werden technisch hergestellt um geteilt zu werden. Im Bild des Jungbrunnens [wie kommt man vom Fotokopierer in den Jungbrunnen?] verbindet sich die Vorstellung des Vordringens in unbekannte Welten, des Unbewussten ..., des reinigenden Bades ...und der Stillung des Durstes nach höherer Erkenntnis [also körperliche Verjüngung = höher Erkenntnis? Soso]. Der menschliche Körper ist Gegenstand von Manipulationen durch Kosmetik und Operationen, Diäten und Sport in mehr oder weniger aggressiver, ausgrenzender Weise ...“
Und dazu gibt’s ein 8-minütiges Video mit dem Titel „Der Jungbrunnen 2.0“, das mal einen Fotokopierer zeigt, mal skizzenhaft hingestrichelte sportlich-schlanke Mädchenfiguren in diversen Posen. Ich weiß, die Frage ist verpönt, aber ich stelle sie dennoch immer wieder: ‚Und was soll das?‘ Hier ersatzweise: ‚Wo bleibt die Utopie?“
‚Wo bleibt die Utopie?“ könnte man immer wieder fragen.
In ein paar Fällen wird immerhin versucht, durch den Titel einen (wenn auch vagen) Bezug zur Kirche und damit zu einer Hoffnung auf Erlösung herzustellen: Christel Aytekins „Im Auge Gottes“ zum Beispiel, oder Christel Schulz‘ „Fiat Lux“, wobei letzteres auch noch durch eine ausdrucksstarke Farbkomposition erfreut. – Edith Hausstätter (*1937) lässt ihren Beitrag zwar „ohne Titel“, wenigstgens behauptet sie aber im kurzen Begleittext einen utopischen Gehalt ihres Bildes (= ein fast expressionistisch anmutendes Ensemble aus Blau- und Gelb-Braun-Tönen, das dem Luftbild einer Ozean-Strand-Landschaft nachempfunden sein könnte):
„Dieser Ort – ein utopischer Ort – befindet sich nicht bestimmbar durch Kommen und Gehen zwischen Land und Meer“.
Wenig genug an Interpretation. Aber noch nicht einmal so viel hat offenbar Ursula Horstmann (* 1943) selbst aus ihrem Bild herauslesen können. Sie lässt den Betrachter mit ihrem „Ohne Titel“ völlig allein. – Ebenso wie Karin Oestreich (*1949), deren „Ohne Titel“ wohl durch den Übereinanderdruck verschiedener Fotos entstanden ist und angesichts seiner fast surrealistischen Rätselhaftigkeit zumindest einen zweiten neugierigen Blick provoziert.
So eine richtige Bloch’sche Utopie, das Bild einer besseren Gesellschaft, gibt es eigentlich nur einmal in der ganzen Ausstellung: Andreas Fuchs (1950) legt mit „Gelber Horizont“ eine Fotografie vor, die zunächst einmal durch ihre grafische Klarheit und die Abfolge von Blautönen besticht: die dunklen Töne des bildbeherrschenden Meeres kontrastieren mit dem Hellblau des schmalen Himmels. Beide sind getrennt durch eine dünne gelbe Horizontlinie – ein leuchtender Sandstrand offenbar.
Dagegen möchte man Sigurd Schades (*1946) fotorealistische Karikatur allenfalls als Dystopie, als negative Utopie betrachten, noch lieber als ironisches Spiel mit unserer Gegenwartsrealität: „Utopie“ taucht hier als (hoffnungsvolle?) Vereinigung von Religionssymbolen auf, ansonsten könnte der obdachlose Bettler mit seinem Hund in jeder Fußgängerzone anzutreffen sein. Allerdings sammelt er „für Reiche“ und dementsprechend besteht sein Sammelertrag nicht aus mickrigen Centstücken sondern aus dicken 50- und 100-Euro-Bündeln. Das „Utopische“ sieht Sigurd Schade darin, dass es das „niemals geben wird – eine Geldsammlung für Reiche“. – Ach ja? Was glauben Sie eigentlich, was das Finanzamt jeden Tag macht? Geld sammeln, um damit die – gewiss nicht schmalen – Konten von Rüstungsindustriellen und ihrer wohldotierten Berater zu füllen, die dafür nicht treffende Gewehre und nicht flugtaugliche Flugzeuge liefern (ich hätt‘ noch so manch anderes Beispiel). .
Leer.Raum“ und „Kunst.Raum“ Christuskirche
Noch ein paar Sätze zum Ausstellungsort: Die Christuskirche in Detmold hat sich für 2015 zum „Leer.Raum.Kirche“ erklärt: die üblichen Bänke wurden entfernt, stattdessen wird der leere Raum jeweils dem Anlass entsprechend möbliert (mehr dazu im Gemeindebrief 2014/7, S. 9). Gleichzeitig wird die Kirche zum „Kunst.Raum.Kirche“ – zum Ort für vielerlei (kulturelle, künstlerische) Ereignisse – erinnerrt sei an die Inszenierung „Judas“ des Landestheaters oder das Themenwochenende „Weltkriege“, dessen eindrucksvollste Veranstaltung ebenfalls in der Christuskirche stattfand („Endzeitwälder“ – eine Sternstunde literarischer Gedenkkultur!).
Und nun also die sehenswerte Ausstellung „Utopie – ohne Ort“. Künstlerinnen und Künstler haben sich mit insgesamt 50 Werken dafür beworben. Eine Jury hat davon 19 ausgewählt (mehr dazu: Lippische Landeskirche).
Zwar betont Pfarrer Fleck in seiner Einführung, dass die Christuskirche als „reformierter Gottesdienstraum“ selbst „bildfrei“ sei („selbst eine Utopie in einer bilderüberfluteten Gesellschaft“), und man könnte den Eindruck haben, die Veranstalter wollten eine gewisse „Bilderfeindlichkeit“ selbst in dieser Ausstellung demonstrieren, indem die – meist noch nicht einmal gerahmten - Bilder lediglich auf einfachen, geradezu: primitiven Holzspanplatten präsentiert werden. Aber auf die kommt es ja letztlich nicht an. Was viel stärker wirkt, ist die Kirche selbst, die klare, fast möchte man sagen: erhabene Architektur, die den Exponaten einen einmaligen, würdigen Rahmen verleiht.
Und über allem schwebt ein großer goldener „Kokon“ – der Beitrag Monika Möllers (*1963) zu den Utopien. Viele Tiere verleben eine Phase ihres Lebens in einem Kokon, wo sie sich in Ruhe weiterentwickeln. Bekanntestes all dieser Tiere ist der Schmetterling: eine gefräßige und daher herzlich unbeliebte, oft gar als „ekelig“ empfundene Raupe spinnt sich als „Puppe“ in einen solchen Kokon ein und wird dort zum farbenprächtigen Falter, der als „Edelstein der Lüfte“ gepriesen, von Goethe wie von Bushido besungen wurde und sein Leben genießt, indem er von Blüte zu Blüte flattert, mal hier, mal dort zu nascht, Sex hat, um schließlich mit der Eiablage den Zyklus neu zu starten. – Wenn das kein eindrucksvolles Symbol für „Utopie“ ist!
(Ich kann das Unken einfach nicht lassen: In Ballett „Der Teufel tanzt (es) mit mir“ schlüpft aus einem ganz ähnlichen Kokon der Tänzer Gaëtan Chailly, der als „Es“ schnell zur beherrschenden Figur der Geschichte wird, und, so er „nicht selbst der Teufel wär“ diesem doch allein schon über den Titel eng verbunden erscheint).