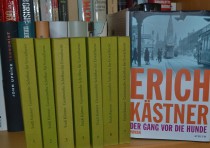Die Ästhetik der Stahlgewitter – Das Grauen im „Wäldchen 125“
„Weltkriege“ – ein Landestheater-Themenwochenende
„Am Tag der Verbrennung meiner Bücher in Deutschland:
Wer den Zusammenbruch von 1933 begreifen will,
muss die Ereignisse der Jahre 1918 und 1919 kennen ...
Nein, in 15 Jahren haben sie nichts gelernt.
Die Folgen sind furchtbar.
Das Volk lernt ja zu sagen zu seiner kriegerischen Gewaltlust.
... Lerne die Tugend des Barbaren ...
verlerne, des anderen Leiden zu fühlen ...
du bist ein Held, verachte friedliches Leben ...,
höchstes Glück der Menschheit ist der Krieg“
Ernst Toller: Eine Jugend in Deutschland
(Kapitel 1 & 18)
WaSa - Detmold. „Was für eine absurde Welt!“, stöhnte ein Bekannter beim Verlassen der Christuskirche. „In der Ukraine, in Afrika krepieren Menschen; und wir delektieren uns hier an edlen Stimmen und schöner Musik!“
Soeben hatten wir an der Auftaktveranstaltung zum „Themenwochenende“ teilgenommen: „100 Jahre Erster Weltkrieg – 75 Jahre Zweiter Weltkrieg“. An zwei Tagen will das Landestheaters erinnern an „die Allgegenwart von Hass und Tod“ im Krieg, an die damit einhergehenden „ungeheuerlichen Schändungen und Zerstörungen“; aber auch an die Versuche, an die Bestrebungen gerade von Künstlern, sich angesichts all des Schrecklichen dennoch „das Mitgefühl, den Sinn für Schönheit und Momente von Humanität zu bewahren“ (um es vorwegzunehmen: in der letzten Veranstaltung der beiden Tage wird dieser Anspruch fulminant eingelöst werden – s.u.).
Für dieses Wochenende hat das Landestheater Gäste eingeladen, aber auch zahlreiche eigene Kräfte aufgeboten. Auf dem „regulären“ Spielplan stand das Stück, das vielleicht am deutlichsten für das Spielzeitmotto „Schlachten Feste Katastrophen“ steht: Grabbes (Ab-)Schlacht- und Schlachtenstück „Herzog Theodor von Gotland“. Und auf der kleinen Bühne wurde Düffels „Weltkrieg für alle“ gespielt – das man mit etwas gutem Willen als die Farce ansehen kann, die schon bei den griechischen Klassikern auf die Tragödie(n) folgte: die tragisch-groteske Geschichte des Weltkriege-Veteranen, für den die Kriege nie aufgehört haben, für den der Krieg immer weiter und weiter geht.
Zwischen Bestialität und Humanität – Lothar Ehrlichs Grabbe-Vortrag
Eines der Highlights des Wochenendes ist – im Umfeld der Grabbe-Tragödie – ein Vortrag des Vize-Präsidenten der Grabbe-Gesellschaft, Professor Lothar Ehrlich aus Weimar: „‘Es schwebt ein holder Genius über meinem Leben‘ – Grabbe zwischen Wahn und Realität“. Neben dem Versuch (soweit das in der knappen Zeit möglich ist), Leben, Werk und Wirkung von „Detmolds berühmtestem Sohn“ zu skizzieren, beeindruckt Ehrlich – ausgehend von Grabbes „Gothland“ und seinem „Napoleon“ - mit faszinierenden Gedankenanstößen zum Wesen unserer Gattung: Der Mensch, der das Stadium des Tiers hinter sich gelassen hat, sich aber schwer tut, sich zwischen „Gut“ und „Böse“ zu entscheiden, der es immer noch nicht geschafft hat, den Weg von der „Bestialität“ zur „aufgeklärten, klassischen Humanität“ zu vollenden. Später am Tag, wenn Helene Grass Ernst Jüngers „Wäldchen 125“ liest, wird man wieder daran denken!
Die Ästhetisierung des Hässlichen
Ein Aspekt dieses Verlorenseins zwischen Bestialität und Humanität: der Antagonismus, aber auch das Wechselspiel zwischen Kultur und Barbarei; die Leidenschaft, mit der die „schönen Künste“ gerade auch die hässlichen, die abscheulichen Seiten der Bestie Mensch thematisieren. Nur so konnte es ja zu der Klage meines Bekannten kommen: Wir delektieren uns an der gefälligen Darstellung des Scheußlichen. An der Ästhetisierung des Hässlichen.
Was berührt uns mehr: (negativ) das „morgen geht’s in Grab“ in Hebbels düsterer Ballade „Memento vivere“? Oder doch (positiv) der herrliche Bariton Andreas Jörens, der Rudi Stephans Vertonung stimmgewaltig vorträgt?
Oder das Elend der Kinder im Krieg - auf welcher Seite der „Erbfeindschaftsgrenze“ auch immer: ob in Hanns Eislers „Kriegslied eines Kindes“:
„Meine Mutter wird Soldat,
da zieht sie rote Hosen an ...
dann kommt sie in den Schützengrab'n,
da fressen sie die Rab'n ...
Dann kommt sie ins Lazarett,
da kommt sie ins Himmelbett,
trara tschindra, meine Mutter wird Soldat!“
ebenso wie in
Debussys „Weihnachtslied für Kinder, die kein Haus mehr haben“:
„Nous n’avons plus de maisons!
Les ennemis ont tout pris, tout pris,
Jusqu’à notre petit lit!
Ils ont brûlé l'ecole, et notre maître aussi. …
Papa est à la guerre,
Pauvre maman est morte!
Noël! Noël, surtout, pas de joujoux!
Tachez de nous redonner le pain quotidian”
“Wir haben kein Haus mehr.
Die Feinde haben alles genommen, alles genommen.
Sogar unser kleines Bett!
Sie haben die Schule angezündet, und unsern Lehrer auch. ...
Papa ist im Krieg.
Die arme Mama ist tot! ...
Weihnachten! Weihnachten!
Vor allem kein Spielzeug!
Versuche, uns das tägliche Brot wiederzugeben!“
Wie herzzerreißend müsste das auf uns wirken! Und doch verblasst das Schreckliche hinter Klang und Schönheit – dem Klang von Lutz Rademachers Klavierspiel und vor allem hinter der Schönheit von Kirsten Labontes Sopran, zumal sie Debussy im französischen Original singt, so dass vermutlich die Mehrheit den Text nicht versteht (dessen deutsche Übersetzung allerdings jeder in in die Hand bekommen hat).
Geradezu verblüfft hat mich der Vortrag des Brecht-Weill-Songs „Zu Potsdam unter den Eichen“: Es ist schon recht ungewohnt, diese Soldatensarg-Ballade von einem Opernchor in getragener Weise von einer Kirchenempore herab singen zu hören - ebenso wie danach die „Legende vom toten Soldaten“ – verbindet man diese Lieder doch sonst eher mit der knarzenden Stimme eines Ernst Busch (--> "Zu Potsdam ...".: "... toten Soldaten" ).
Etwas erschrocken bin ich darüber, dass Ernst Jünger gleich mehrfach Berücksichtigung fand – in der Eröffnungs- wie in der Abschlussveranstaltung. Einst, während des Studiums, sahen wir ihn als Faschisten. Und nicht nur linke Studenten warfen ihm die Ästhetisierung und Verharmlosung der Kriegsschrecken vor:
„Kurz vor 10 Uhr abends setzte ein Feuersturm ein. Nach kurzer Zeit waren wir völlig in Rauch und Staub gehüllt. Während des uns umbrausenden Orkans [standen die] Leute in steinerner Unbeweglichkeit, das Gewehr in der Hand. ...beim Scheine einer Leuchtkugel sah ich Stahlhelm an Stahlhelm, Seitengewehr an Seitengewehr blinken und wurde von dem stolzen Gefühl erfüllt, einer Handvoll Männern zu gebieten, die vielleicht zermalmt, nicht aber besiegt werden konnten. In solchen Augenblicken triumphiert der menschliche Geist über die gewaltigsten Äußerungen der Materie, der gebrechliche Körper stellt sich, vom Willen gestählt, dem furchtbarsten Gewitter entgegen.“ (aus: In Stahlgewittern)
Aber natürlich: längst gilt Jünger als deutsche Geistesgröße; nach dem Eisernen Kreuz und dem Heldenorden „Pour le Mérite“ hat er schon 1959 das Große Bundesverdienstkreuz erhalten, welches 1985 mit Stern und Schulterband noch aufgehübscht wurde; man hat ihn mit weiteren Ehrungen überhäuft; Helmut Kohl ist regelmäßig zu ihm nach Wilflingen gepilgert ... Und sein Vorwort zu „Stahlgewittern“ von 1922 wird in den neuen Auflagen schon lange nicht mehr abgedruckt:
„Wir haben viel, vielleicht alles, auch die Ehre verloren. Eins bleibt uns: die ehrenvolle Erinnerung an euch, an die herrlichste Armee, die je die Waffen trug und an den gewaltigsten Kampf, der je gefochten wurde. Sie hochzuhalten inmitten dieser Zeit weichlichen Gewinsels, der moralischen Verkümmerung und des Renegatentums ist stolzeste Pflicht eines jeden, der nicht nur mit Gewehr und Handgranate, sondern auch mit lebendigem Herzen für Deutschlands Größe kämpfte.“
Ebenso fehlen in heutigen Ausgaben des „Wäldchens 125“ (dazu unten mehr) Sätze wie: „Ich hasse die Demokratie wie die Pest“ oder: für das „geschäftsmäßige Literatenpack“, das sich für Aufklärung, Demokratie und Pazifismus einsetze, müsse „sofort die Prügelstrafe wieder eingeführt“ werden.
Aber auch für Jünger gilt: „Wer vieles bringt, wird jedem etwas bringen“. Und so passt er denn auch perfekt in die Eröffnungsveranstaltung zu Anti-Kriegs-Tagen: mit der Frage „eines einst Kriegslüsternen: Wann hat dieser Scheißkrieg ein Ende?“
So kommt man also mit zwiespältigen Empfinden aus dieser Auftaktveranstaltung. Bei dem anschließenden Liederzyklus „Komm, lieber Krieg, und mache ...“ (schon dieser Titel!) vermisst man dann fast vollständig den Bezug zum Thema Krieg (es sei denn, man weiß, dass der Komponist Butterworth mit 31 Jahren in der Somme-Schlacht gefallen ist). Hier kann man den herrlichen Bass Michael Zehes bewundern, das gekonnte Klavierspiel Klara Hornigs. Und wer mag, darf mit ihnen und ihren Schubert-/ Butterworth- und Mahler-Liedern in einer morbid-romantischen Todessehnsucht schwelgen .... Und dann auch noch die Zugabe! Heines „Grenadiere“! Mag ja sein, dass Heine diese soldatische Verherrlichung Napoleons („was schert mich Weib, was schert mich Kind? Ich trage weit bessres Verlangen: Lass sie betteln gehn, wenn sie hungrig sind. Mein Kaiser, mein Kaiser gefangen!“) tatsächlich ironisch meinte – in Schumanns Vertonung ist da keine Ironie mehr zu spüren.
„Endzeitwälder“: Der Höhepunkt der zwei Tage – eine Sternstunde!
Hoffentlich hat sich von diesen Erfahrungen niemand davon abhalten lassen, auch noch die Abschlussveranaltung am Sonntag Abend, wieder in der Christuskirche, zu besuchen! Hier wird nämlich – unter dem etwas rätselhaften Titel „Endzeitwälder“ – der anfangs zitierte Anspruch eingelöst: das Schreckliche des Krieges eindringlichst bewusst zu machen und dennoch „den Sinn für Schönheit und Momente von Humanität zu bewahren“.
Die Dramaturgie ist ganz einfach: Ein Tisch. Vier Stühle. Vier Personen: Markus Hottgenroth, Ewa Rataj, Helene Grass, Christoph Gummert. Die vier Ensemblemitglieder des Landestheaters setzen sich hin und beginnen zu lesen.
Es folgt eine Sternstunde literarischer Gedenkkultur!
Von der ersten Minute an ist man in den Bann geschlagen. Die geschulten Schauspielerstimmen in ihrer ruhigen Klarheit lassen einen nicht los, fesseln, nehmen einen mit – in des Wortes doppelter Bedeutung! Gelesen werden Texte von Dichtern, Literaten, die sich zwischen 1914 und 1918 zum Thema Krieg äußern. Dem Landestheater-Dramaturgen Christian Katzschmann gebührt höchstes Lob für die kluge und durchdachte Zusammenstellung der Beiträge!
Vielleicht kommt der Hurra-Patriotismus etwas zu kurz, mit dem auch viele Dichter, Literaten, Künstler – wie die meisten ihrer Zeitgenossen – in den Krieg gezogen sind. Um so deutlicher wird, wie schnell die Betroffenen erkennen mussten, dass Krieg kein munteres Abenteuer ist, sondern Schmerz, Verwundung, Tod. So mancher Dichter hat seine Verzweiflung an diesem Elend hinausgeschrieen, dass es uns heute noch wehtut.
Georg Trakl, zum Beispiel: der 27-jährige Dichter mit Apothekerausbildung musste allein und nahezu ohne Hilfsmittel an die hundert Schwerverletzte versorgen. Der junge Mann ist daran „verdorben und (am 3. November 1914) gestorben“. Dem Schlachtenort Grodek in der Ukraine hat er noch ein schreckliches Denkmal gesetzt, das hier in voller Länge zitiert sei:
Grodek
Am Abend tönen die herbstlichen Wälder
Von tödlichen Waffen, die goldnen Ebenen
Und blauen Seen, darüber die Sonne
Düstrer hinrollt; umfängt die Nacht
Sterbende Krieger, die wilde Klage
Ihrer zerbrochenen Münder.
Doch stille sammelt im Weidengrund
Rotes Gewölk, darin ein zürnender Gott wohnt
Das vergoßne Blut sich, mondne Kühle;
Alle Straßen münden in schwarze Verwesung.
Unter goldnem Gezweig der Nacht und Sternen
Es schwankt der Schwester Schatten durch den schweigenden Hain,
Zu grüßen die Geister der Helden, die blutenden Häupter;
Und leise tönen im Rohr die dunklen Flöten des Herbstes.
O stolzere Trauer! ihr ehernen Altäre
Die heiße Flamme des Geistes nährt heute ein gewaltiger Schmerz,
Die ungebornen Enkel.
Trakl ist nur ein Beispiel für viele Künstler, die zerstört, traumatisiert aus dem Krieg zurück kamen. Oder nicht zurück kamen (dazu sei ein eindrucksvoller SPIEGEL-Artikel aus dem Jahr 1999 nachdrücklich empfohlen: „Der Krieg der toten Dichter“ ).
Ernst Stadler etwa, der gleich zu Beginn zitiert wird: Der Literat könnte heutzutage als Musterexemplar eines europäischen Bürgers gelten: im Elsaß aufgewachsen, deutschsprachig, dem Französischen und Englischen verbunden (Habilitation über Wielands Shakespeare-Übersetzungen). 1914 wurde er als Gastprofessor für deutsche Philologie nach Toronto berufen – doch dann begann der Krieg und der 31-Jährige wurde eingezogen. In Kapitel 16 seines Gedichtzyklusses „Der Aufbruch“ heißt es unter der Jahresangabe 1914:
„Die herrlichste Musik der Erde hieß uns Kugelregen. ...
Vorwärts, in Blick und Blut die Schlacht, mit vorgehaltnem Zügel.
Vielleicht würden uns am Abend Siegesmärsche umstreichen,
Vielleicht lägen wir irgendwo ausgestreckt unter Leichen.“
Er sollte keinen Siegesmarsch hören. Am 30.10.1914 starb er bei Ypern durch eine Granate – gleich in der „Ersten Flandernschlacht“; an die „Dritte Flandernschlacht“ hat später Brecht unter dem Buchstaben Y seines „Alfabet“ erinnert:
„Ypern in Flandern
1917.
Mancher der diesen Ort gesehen
Sah nie mehr einen andern.“
Ein letztes Beispiel: Zitiert wird auch Else Lasker-Schüler, die bereits ihren Freund Trakl verloren hatte. Sie schrieb an den Maler Franz Marc: „Wann wirst Du aus dem Krieg kommen?“ – Der kam nicht zurück. 1916 starb er bei Verdun, 36-jährig. Sein enger Freund und Malerkollege August Macke war schon wenige Wochen nach Kriegsbeginn, mit 27 Jahren, in Frankreich gefallen.
Der längste Text stammt wiederum von Ernst Jünger. Helene Grass liest seine Erzählung „Wäldchen 125“ – wie „Stahlgewitter“ eine Ausarbeitung seiner Kriegstagebücher. Man möchte verzweifeln, wenn man hört, mit welcher Coolness der „Held“ dieser wahren Geschichte einen „Feind“ aufs Korn nimmt – einen Menschen, der sich eben noch mit einem Kameraden unterhalten, vielleicht mit ihm gelacht hat, der sich gewiss über seine Ablösung freut, eine Zigarette raucht und im Weggehen – zurück, in die sichere Etappe – noch etwas sagen will. „Er sollte kein Glück haben“, verkündet der Todesschütze lapidar.
So gekonnt wie die Auswahl der Texte für diese Veranstaltung ist auch die Auswahl der Musik, die hier kein Eigenleben führt, sondern die Inhalte perfekt ergänzt, unterstreicht – besonders Garrett Mendelows Schlagzeugsolo („Psappha“ von Jannis Xenakis) und Dragan Ribic‘ jammernde Akkordeonstücke; aber auch das Saxofon-Quartett (Tobias Hägele, Martina Ebert, Kristina Matthies und Martin Müller; alle von der Hochschule für Musik Detmold).