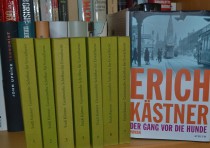Billige Sparversion oder intensives Kammerspiel?
Schillers Kabale und Liebe am Landestheater
WaSa – Detmold. Wissen Sie, was Teichoskopie ist? Mit diesem griechischen Begriff für „Mauerschau“ bezeichnet man den alten Theatertrick, etwas in Echtzeit zu schildern, was man auf der Bühne nicht darstellen kann (oder will). Da steht also beispielsweise jemand auf einer Stadtmauer und berichtet denen drinnen von der Schlacht draußen. Im postdramatischen Theater, wo Einheit von Zeit, Raum und Handlung nicht mehr existiert, und wo Videoeinspielungen beliebige Exkurse erlauben, braucht man diesen klassischen Kunstgriff kaum mehr. Aber vielleicht verhelfen ihm ja Sparzwänge zu einer neuen Renaissance. Das wär’s doch, Ihr kürzungs-geplagten Intendanten: Ihr setzt einen einzigen Schauspieler auf die Bühne, und der spielt einen Zuschauer, der erzählt, was er auf der Bühne sieht ... den ganzen Faust, beispielsweise (Stemanns Hamburger Faust, der in diese Richtung ging, wurde Inszenierung des Jahres), oder Kabale und Liebe?
Dem Vernehmen nach ist die wirtschaftliche Situation des Landestheaters Detmold noch vergleichsweise gut. Finanzielle Zwänge werden es also nicht gewesen sein, welche Martin Pfaffs „Kabale und Liebe“-Inszenierung wie eine Sparversion aussehen lassen: Man verzichtet ganz auf Kulissen; allerdings liegen auf der ansonsten nackten Bühne die Trümmer eines Pegasus. Auch für die Kostüme hat Ines Alda keinen ungebührlichen Aufwand getrieben: man trägt heutige bürgerlich-gehobene Alltagskleidung; Lady Milford brezelt sich nicht auf für das Treffen mit der Rivalin; und geradezu bescheiden tritt der eitle Hofmarschall auf: kein „reiches aber geschmackloses Hofkleid“ nebst allerlei Accessoirs, wie von Schiller vorgegeben, geschweige denn, dass er à la Hérisson frisiert wäre.
Sogar auf einfachste Requisiten verzichtet man: der Geiger geigt pantomimisch, die dazugehörenden Töne kommen aus dem Off vom Klavier. Und selbst den unseligen Brief schreibt Luise nicht auf Papier, sondern in weit ausholenden, vom Sekretär geführten Gesten in die Luft. Dass sie dazu exponiert vorne an der Rampe steht, gibt Jenny Ellen-Riemann die Gelegenheit, das Elend dieser Luise durch Mimik und Körpersprache zum Ausdruck zu bringen – grandios!
Und am Personal wird gespart: An diesem absolutistischen Hof gibt es keinerlei Dienstboten, so dass einige Szenen quasi automatisch wegfallen: der Abschied der Lady von ihrem Personal zum Beispiel, oder die Kammerdiener-Szene. Allerdings: so ganz hat man sich doch nicht getraut, diese Lieblingsszene sämtlicher von ’68 übriggebliebenen Studienräte zu streichen – an dieser Stelle kommt nun also die gute alte Teichoskopie zum Einsatz, auch wenn kein räumlicher sondern ein zeitlicher Abstand damit überbrückt wird: die Geschichte von den verkauften Landeskindern wird von Lady Milford nacherzählt, wobei dieser Wechsel vom dramatischen Dialog zum etwas langatmigen Monolog nicht wirklich überzeugen kann!
Auch sonst ist Schillers Text stark gekürzt – immerhin so geschickt, dass sich keine allzugroßen Lücken im Sinnzusammenhang auftun.Am gravierendsten ist vielleicht der komplette Wegfall der Schlussszene. Man sieht das unglückliche Paar zwar am Gift dahinsiechen, aber vor dem Tod fällt (bildlich gesprochen) der Vorhang; mit Luises Klage „sie machten es listig“ endet Pfaffs Inszenierung. Die letzte Konfrontation mit dem Vater entfällt. So manches Atmosphärische – gerade auch zum Verhältnis Adel / arme Leute - vermisst man dann doch. Aber hierfür findet Pfaff Bilder, oft nur kleine, aber herrlich gelungene Gesten – zweierlei Handküsse, zum Beispiel. Auch trägt der Präsident seinem Sohn nicht die ehrenwerte Gräfin von Ostheim als Braut an – und man fragt sich, warum dann nicht auch der darauf hinzielende Vorschlag des Sekretärs herausgekürzt wurde.
Was bleibt schließlich noch? In dieser unaufwändigen, auf weniger als zwei Stunden (ohne Pause) zusammengestrichenen Inszenierung? Ein dichtes Stück Sozialgeschichte. Ein intensives Kammerspiel über quälende und gequälte Menschen. Konzentrierter Schiller!
Wer den zerbrochenen Pegasus, das in Trümmer geschlagene Dichterross, welches die Bühne beherrscht, als schlechtes Omen genommen, wer eine Klassiker-Zertrümmerung befürchtet hat, der sieht sich angenehm enttäuscht. Das revolutionär-humane Menschenbild des jungen Schiller, des Dichters grandiose Sprache feiern in dieser Inszenierung Triumphe, auch wenn etwa Luises Herzensergüsse manchmal arg naiv-kitschig in heutige Ohren klingen („Ich entsag ihm für dieses Leben“).
Triumphe feiern auch die Darsteller, die hier mal wieder so richtig Gelegenheit bekommen, ihr Können zu zeigen. Das junge Liebespaar (Jenny Ellen-Riemann, Martin Krah) wird von den zahlreich vertretenen Schüler-innen ohnehin geliebt und am Schluss begeistert umjubelt.
Miller (Jürgen Roth) ist hier nicht nur guter (wenn auch strenger) Vater sondern auch ein Stück weit Egoist. Die theologische Diskussion um Selbstmord und Sünde würgt er rasch ab und führt stattdessen schnell die „Kapitale der Väter“ ins Feld. Sein „stirb!“ klingt eher brutal denn verzweifelt. Kerstin Klinder als Mutter gibt in ihren kurzen Auftritten anschaulich die ungebildete Frau aus dem Volk mit dem naiven Drang nach Höherem. Der fiese Sekretär Wurm ist mal wieder ein Paraderolle für Philipp Baumgarten, der aber – angemessen sparsam dosiert – auch mal durchscheinen lässt, dass selbst in diesem Ekelpaket ein Mensch mit Sehnsüchten und Problemen steckt. Und Robert André Augustin schafft es auch ohne große Toilette, den Hofmarschall ganz einfach als eitlen, eingebildeten Fatzke zu zeigen – ganz so, wie er in Schillers Buche steht.
Hervorragend schließlich Joachim Rucsynski als Präsident; auch hier beeindrucken vor allem die kleinen Gesten, der ganz leise ironische Sarkasmus etwa („Ist das möglich?!“) , mit dem er seine intellektuelle Überlegenheit gegenüber dem Hofmarschall demonstriert. Und – für mich der Star des Abends – Ewa Rataj als Lady Milford. Im Gespräch mit Ferdinand ist sie die edle Britin mit einer herzerwärmenden (Mit-)Menschlichkeit, in der Szene mit Luise ebenso gekonnt und glaubhaft die überlegene, erfahrene und mächtigere Rivalin, die durch ihre Arroganz abstößt.
Der Beifall war verdientermaßen herzlich-lebhaft.
mehr Fotos: www.kulturinfo-lippe.de