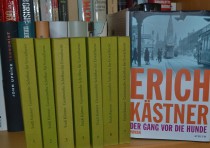„ … der Seele Schwingen belastet mit Erdenstaub …“
Gorkis „Kinder der Sonne“ in Detmold
Ein Autor von unten aus der Tiefe
(g.wasa - Detmold) Gorki wurde als Alexei Maximowitsch Peschkow im März 1868 in der alten russischen Handelsstadt Nischni Nowgorod geboren. Er stammte aus ärmsten Verhältnissen. Sein Großvater hatte als Wolgatreidler gearbeitet (also Schiffe flussaufwärts gezogen) und war wohl ein brutaler Familientyrann – was der kleine Alexei oft genug schmerzlich zu spüren bekam, als er nach dem frühen Tod seiner Eltern bei den Großeltern aufwuchs. Nach nur drei Schuljahren befand der Großvater, sein Enkel habe jetzt Geld zu verdienen; und der junge Peschkow musste vielfältigen Tätigkeiten nachgehen: vom Lumpensammler bis zum Ikonenmaler, als Küchenjunge und Hafenarbeiter, als Vogelverkäufer und Nachtwächter …
Er litt unter seinem Mangel an Bildung, den er als Autodidakt durch exzessives Lesen zu beheben suchte. Ein späterer Versuch, an einer Universität angenommen zu werden, scheiterte.
Um 1890 wanderte er zu Fuß durchs Zarenreich, kam in Tiflis mit revolutionären Kreisen in Kontakt – und damit ins Visier der Polizei. Seine neuen Freunde ermutigten ihn, seine Erfahrungen aufzuschreiben. 1892 veröffentlichte er seine erste Erzählung „Makar Tschudra“ unter dem Namen „Maxim Gorki“, auf Deutsch: „der größte Bittere“. Dieses Pseudonym behielt er bei.
Die Folgejahre waren bestimmt von politisch(-revolutionärem) Engagement und schriftstellerischen Erfolgen – vor allem mit dem 1902 von Stanislawski uraufgeführten Stück „Na dne“, das in Deutschland unter dem Titel „Nachtasyl“ bekannt ist - eine verharmlosende Übersetzung, angesichts der Bedeutung von „Asyl“ als einer bewahrenden, schützenden Einrichtung. Eigentlich bedeutet der Titel „Am Boden“, wird gelegentlich auch – zutreffender - als „Unten in der Tiefe“ übersetzt: Gorki schildert darin drastisch das Leben derer „am Boden“, wobei es sich durchaus nicht durchweg um „Asoziale“ handelt, sondern auch um „ehrbare Handwerker“, die aber in der russischen Feudalgesellschaft zu einer Existenz ganz „da unten“ verdammt sind: ein Mützenmacher etwa oder der Schlosser Kleschtsch, der mit seinem dauernden Gefeile und Gehämmer ein Vorläufer des Störenfriedes Jegór in den „Kindern der Sonne“ ist.
Trotz seines sozialen Engagements und seiner revolutionären Gesinnung blieb Gorkis Verhältnis zu Lenin und später zur Oktoberrevolution 1917 zwiespältig. Nach einem Exilaufenthalt zwischen 1906 und 1913 ging er 1921 – nach Problemen mit der Zensur – wieder ins Ausland und kehrte erst 1931 zurück. Bis zu seinem Tod (Juni 1936) wurde er einerseits von Stalins Polizei misstrauisch überwacht; andererseits erfuhr er zahlreiche Ehrungen (Leninorden; Mitglied des Zentralkomitees der KPdSU). Als herausragender Vertreter des „Sozialistischen Realismus“ wurde er 1927 von der Kommunistischen Akademie als „proletarischer Schriftsteller“ geehrt. Und neben Stalin und Lenin wurde ihm die Ehre zuteil, Namenspatron einer Großstadt zu werden: Seine Geburtsstadt Nischni Nowgorod hieß von 1932 bis 1990 „Gorki“.
Eine Geschichte aus den „besseren Kreisen“
„Nachtasyl“, das Drama aus der Tiefe, stand 2004 auf dem Spielplan des Landestheaters Detmold. Jetzt bringt Schauspieldirektor Jan Steinbach ein anderes Gorki-Stück auf die Bühne: „Kinder der Sonne“, verfasst 1905 im Gefängnis, nach dem „Petersburger Blutsonntag“, an dem Hunderte streikender Arbeiter erschossen worden waren und in dessen Folge Gorki verhaftet worden war. „Historischer Hintergrund sind die Wolgaaufstände 1892 während einer Choleraepidemie – das in Unwissenheit und extremer Armut gehaltene Volk hatte sich gegen die privilegierte Obrigkeit erhoben“, erläutert Dramaturgin Sophia Lungwitz im Programmheft und fragt: „Was sind das für Menschen, die in Gorkis Stück aufeinandertreffen?“
Die Mehrzahl dieser Menschen findet man nicht in einem „Nachtasyl“; sie leben oder treffen sich in einer großen herrschaftlichen Wohnung, gehören also nicht etwa zum Bodensatz der Gesellschaft, sondern sehen sich als „Kinder der Sonne“, fühlen sich den besseren Kreisen zugehörig, auch wenn ein Protagonist vor einiger Zeit gezwungen war, sein Haus zu verkaufen und nun schon mal die Miete schuldig bleiben muss: Pawel Protassow (André Lassen) widmet sich voll und ganz der (offenbar brotlosen) Wissenschaft der Chemie – ein Musterexemplar des weltfremden Gelehrten im Elfenbeinturm, „mit dem verrückten Versuch beschäftigt, den Homunkulus zustande zu bringen“, wohingegen ihn die Menschen in seinem Umfeld nicht interessieren, nicht einmal seine Frau, die schöne Jelena (Katharina Otte). Die wird dafür von dem Maler Wagin (Leonard Lange) umworben. –
Protassows Schwester Lisa (Alexandra Riemann) scheint krank zu sein – offenbar leidet sie an einer posttraumatischen Belastungsstörung nach einem Gewalt-Erlebnis (womöglich während des „Petersburger Blutsonntags“). Wegen ihrer Krankheit glaubt sie, dem Werben des Tierarztes Tschepurnoj (Gernot Schmidt) nicht nachgeben zu dürfen. Dieser „möchte so gern einen guten Menschen kurieren“, stattdessen darf er „dem Hündchen der Frau Kameralhofdirektor das eingeklemmte Schwänzchen verbinden“; ansonsten chillt er – mithilfe von Alkohol - im Hause Protassows. - Tschepurnojs Schwester Melanija (Manuela Stüßer) hat einst als armes Waisenkind einen reichen alten Knacker geheiratet, denn dies ist (in den Worten des Dienstmädchens Fima (Meike Hoßbach), welches vor dem gleichen Schritt steht) „immer noch besser, als auf die Straße zu gehen … so ist’s wenigstens einer und nicht Hunderte …“ (so der Wortlaut meiner Textausgabe; in Steinbachs Inszenierung heißt’s drastischer: „besser, als auf den Strich zu gehen“). Jetzt ist Melanija eine reiche Witwe, die ebenso naiv wie leidenschaftlich (und erfolglos) für Protassow schwärmt … -
Ein Außenseiter ist der Hausbesitzer Awdejewitsch (fast schon mafiös: Banar Fadil), ein Wiedergänger Lopachins aus dem „Kirschgarten“: ein Emporkömmling, der mit seinem robusten Geschäftssinn das degenerierte russische Feinbürgertum bald hinter sich lassen wird („Sie werden immer reicher, was? – Wie soll ich sagen? Ich breite mich aus.“)
Die Zeit plätschert dahin, als ob wir auf einem Tschechow’schen Landgut wären. Der erste Blick auf die Bühne zeigt zwei Elemente (die im Verlauf des Abends immer wieder umeinander kreisen): das Labor des weltfernen Professors (eigentlich nur ein Tischen mit etwas Equipment) und eine lange, aus mehreren Einzeltischen zusammengestellte Tafel – Platz für gemeinsame Mahlzeiten, für gesellige Runden?
Kaum! – Noch nicht einmal zum obligatorischen Tee kommt man zusammen. Für Gespräche zieht man sich eher ein Einzeltischchen beiseite. Auch die wilden Tänze, mit denen die Regie die Aktschlüsse akzentuiert, lassen weniger an „gemeinsam“ denken als an „isoliert“ wo nicht „gegeneinander“ (wobei man – nebenbei – die Musik eher an der schönen blauen Donau verortet als am Wolgastrand).
Ewige Frage der Philosophen: Was ist der Mensch?
Die (Streit-)Gespräche kreisen unter anderem um die ur-philosophische Frage „Was ist der Mensch?“. Und Gorki legt seinen Figuren ein breites Spektrum von Antworten in den Mund:
- „… ein mit Vernunft begabtes Wesen. …das herrlichste, das erhabenste Wesen auf Erden“ (Protassow)
- „… dass die Menschen Tiere, dass sie roh und schmutzig sind“ … „man kann etwas Nützliches und Angenehmes lieben, z. B. ein Schwein, das uns Schinken gibt, Musik, Bilder kann man lieben. Aber den Menschen – nein! Er ist weder nützlich noch angenehm“. – „… habgierig und dumm …“. – „Der Mensch ist Mensch, solange er spricht, wenn er handelt, zeigt sich das Tier.“ (Tschepurnoj)
- „… je bedeutender ein Mensch ist, umso mehr ist er mit Abgeschmacktheiten behaftet“ (Jelena)
- „… Menschen habe ich noch nicht kennengelernt … ich habe unter Kaufleuten gelebt“ (Melanija)
- „Wie grausam ihr alle seid … unnachsichtig und boshaft“ (Lena)
- „Wir sind die Kinder der Sonne! Wir, die Kinder der Sonne, dieser hellen Lebensquelle entsprossen, wir werden den schwarzen Schrecken des Todes überwinden! Die Sonne erweckt in uns feurige, stolze Gedanken, sie durchleuchtet die Finsternis unserer Zweifel …“ (Protassow)
Gespaltene Gesellschaft: „Oben“ und „Unten“
Ausgerechnet der seiner Mitwelt entfremdete Gelehrte verkündet diese optimistische Vision einer künftigen, besseren Menschheit. Seine Schwester Lisa schwärmt zunächst: „wie schön das ist! Kinder der Sonne!“ Aber dann ist sie die Realistin, die an die triste Gegenwart erinnert: Nicht nur ihre „Seele ist zerrissen“, vor allem ist die Gesellschaft zerrissen, gespalten in das Oben der „Aare“ und der Sonnenkinder und das Unten eines „blinden Maulwurfsgeschlechts von Schwerbedrückten“ (ausformuliert in einem Gedicht, das ob seiner poetischen Schönheit und seiner Ausdrucksstärke am Ende dieses Textes vollständig wiedergegeben wird).
Lisa ist auch diejenige, die sich überhaupt Gedanken um die unteren Schichten macht: „Sieh doch nur den Abgrund, der dich von deiner Köchin trennt“. Dabei scheint das Hauspersonal noch zu den Privilegierteren der Unterschicht zu gehören: hier vor allem die allgegenwärtige Haushälterin Antonowna (Natascha Mamier), die als einstiges Kindermädchen von Pawel und Lisa eine gouvernantenhafte Autorität für sich in Anspruch nimmt, aber auch Dienstmädchen Fima, das zwar mal protestiert („Wir sind doch auch Menschen“), das sich aber immerhin aufgrund seines Aussehens einen wohlhabenden „Ehemann“ (oder Freier?) aussuchen kann.
Ansonsten wird die Unterschicht nur durch den Schlosser Jegór (Patrick Hellenbrand) vertreten, welcher es als sein gutes Recht ansieht, seine Frau grausam zu verprügeln (eine Reminiszenz an Gorkis brutalen Großvater?), und auch mal für eine – fast schon klamaukige – Prügelszene bei den feinen Leuten sorgt. Jegórs (versoffenen?) Kumpel Tróschin taucht im Detmolder Personenverzeichnis erst gar nicht auf (und wird auch nicht weiter vermisst).
Zeitlos: die Pandemie
Ansonsten bleibt „das in Unwissenheit und extremer Armut gehaltene Volk“ anonym und im Wesentlichen fern der Detmolder Bühne – ist aber als Bedrohung des komfortablen Lebensstils von Protassow & Co. präsent. Dies vor allem dann, wenn die Cholera ausbricht. (Man erinnert sich: Historischer Hintergrund des Stücks waren die Wolgaaufstände 1892 während einer Choleraepidemie.)
Es sind vor allem die „kleinen Leute“, die – einerseits – der Seuche zum Opfer fallen (Jegór: „Also stirb! heißt es! Sind wir denn nicht auch Menschen?“). Und es ist – andererseits – das ungebildete Volk, das sich von Fake-News und Verschwörungstheorien leiten lässt:
„Das Volk behauptet, dass es überhaupt keine Seuche gibt … aber dass die Herren Doktoren ihrer Praxis wegen vorgeben … Der Chemiker ist der Hauptverbrecher! Der macht Medizinen …“
… und schon mal handgreiflich wird: … „sie haben die Lazarettbaracke zerstört“ … greifen den Arzt an …“ (Ungefähr zur Zeit der Premiere berichtet der SPIEGEL, dass Gesundheitsminister Lauterbach unter Polizeischutz steht.)
So kriegen die „Kinder der Sonne“ plötzlich eine hoch-aktuelle Schlagseite, ohne dass die Theatermacher viel dazutun müssen.
Ansonsten habe ich kaum Aktualisierungen entdeckt – es sei denn die reichlich rätselhafte, um nicht zu sagen: sinnlose Bemerkung „Mein Kühlschrank hat auch den Geist aufgegeben“ (laut Wikipedia gab’s Kühlschränke für den Hausgebrauch erst gut 20 Jahre nach der „Kinder der Sonne“-Uraufführung – kein Wunder, dass ich diese Bemerkung in meinem Text nicht wiedergefunden habe).
Die Ausstaffierung:
Dagegen läuft die „gute Gesellschaft“ in unförmigen (aber bei näherem Hinsehen durchaus eleganten!) Bade- bzw. Morgenmänteln rum, unter denen sich unförmige, (mittels Polstern und Fatsuits aufgeblähte) fette Körper abzeichnen: Ein ins Bild gesetzter Gegensatz zwischen der armen, ausgehungerten aber ordentlichen Unterschicht und den faulen, vollgefressenen vornehmen Tagedieben? Auch das hat sicherlich nichts mit Aktualisierung zu tun (umso weniger, als die Klischees heutzutage ja gerade andersrum funktionieren: sport-biodiät-chirurgie-optimierte Schicki-Micki-Körper contra Couch-Potato-Prekariat). Und doch klingt die Begründung des Regisseurs zeitgemäß wenn nicht gar zeitlos:
Ihm geht es um „die mentale Trägheit und Handlungsunfähigkeit der Figuren … Sie verfestigen dieses Verhalten immer mehr zur Ausweglosigkeit, werden schwerer und unbeweglicher und können diesen Zustand kaum noch abstreifen“.
Der Schluss: tragisch … und poetisch
Auf den – eher nur angedeuteten – Aufstand der Unteren folgt noch die Katastrophe in besseren Kreisen: Tierarzt Boris Tschepurnoj hat sich aus Frust über Lisas Abweisung aufgehängt. Der verzweifelten (nach Meinung mancher Interpreten: (endgültig) wahnsinnig gewordenen) Lisa gehört das Schlusswort:
„Ich habe ein Gedicht für Boris geschrieben.
Kennt ihr Boris? – Nein?
Ihr tut mir Leid!“
Lisas Gedicht in seiner melancholischen Trauer verdient es, hier wenigstens auszugsweise wiedergegeben zu werden:
„Mitten durch die Wüste geht mein Liebster
In des heißen Sandes rotem Meer,
Seiner harrt in blauer Nebelferne
Einsamkeit, ich fühl's, und Trübsal schwer.
Einem bösen Auge gleicht die
Sonne,
Schweigend brennt herab ihr glühn'der Blick;
Zu dem Liebsten, der dort einsam leidet,
Komm ich, und ich teile sein Geschick.
…
Und zu zweit, versengt von
Sonnengluten,
Wandern in dem Sande wir allein
Und begraben dort in toter Öde –
ER den Traum – und ICH die Herzenspein.“
… ebenso (wie oben angekündigt) Lisas poetische Gesellschaftsanalyse:
„Es hebt sich auf leuchtendem
Flügel
Zum Himmel der Königsaar –
O könnt ich empor zu der Höhe,
die meine Sehnsucht war.
Hinauf, doch vergebliches
Ringen,
Ich bleibe der Erde Raub.
Es sind meiner Seele Schwingen
Belastet mit Erdenstaub.
Ich lieb eure purpurnen Träume,
Euer kühnes Streiten ums Recht –
Doch weiß ich in düsteren Höhlen
Ein blindes Maulwurfsgeschlecht.
Sie freut nicht des Denkens
Wonne
Und nicht der Sonne Pracht,
Den Schwerbedrückten hilft nur
Werktätiger Liebe Macht.
Und wie ein Wall, ein stummer,
Stehn sie zwischen mir und euch –
O sagt, wie führ ich die Ärmsten
In meiner Liebe Reich!“
Landestheater Detmold:
Kinder der Sonne
Schauspiel von Maxim Gorki
Deutsch von Ulrike Zemme
Besetzung:
Inszenierung Jan Steinbach
Bühne Franz Dittrich
Kostüme Jule Dohrn-van Rossum
Dramaturgie Sophia Lungwitz
Licht Udo Groll
Ton Timo Hintz
Maske Kerstin Steinke
Pawel Fjodorowitsch Protassow André Lassen
Lisa, seine Schwester Alexandra Riemann
Jelena Nikolajewna, seine Frau Katharina Otte
Boris Nikolajewitsch Tschepurnoj Gernot Schmidt
Melanija, seine Schwester Manuela Stüßer
Dmitrij Sergejewitsch Wagin Leonard Lange
Antonowna, Kindermädchen Natascha Mamier
Nasar Awdejewitsch Banar Fadil
Mischa, sein Sohn Banar Fadil
Fima, Dienstmädchen Meike Hoßbach
Jegor, Schlosser Patrick Hellenbrand
Awdotja / Luscha / Roman Statisterie des Landestheaters
Nächste Termine im Landestheater:
Mi, 07.06.23, 19:30 Uhr
Fr, 23.06.23, 19:30 Uhr
Sa, 24.06.23, 19:30 Uhr