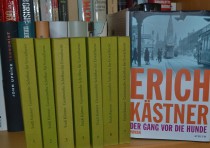Im ersten Kreis der Hölle
Dea Lohers bedrückendes Drama "Am Schwarzen See"
Hervorragende Inszenierung im Detmolder Grabbe-Haus
Dea Loher: eine alte Bekannte in Detmold
WaSa – Detmold. Die 1964 geborene Dea Loher ist eine der erfolgreichsten zeitgenössischen Dramatikerinnen. Vom Förderpreis des Goethe-Instituts bis zum Mülheimer Dramatikerpreis verfügt sie über eine ansehnliche Sammlung von Auszeichnungen. Und vor allem: ihre Stücke werden landauf – landab gespielt!
Dabei liefert sie alles andere als leichte Kost! Altgediente Detmolder Theaterbesucher erinnern sich vielleicht noch an ihr Stück „Tätowierung“, das Anfang des Jahrhunderts auf dem Spielplan des Landestheaters stand. Damals ging es um Kindesmissbrauch in der Familie; und ich war damals begeistert: von der Autorin („kühle Beobachterin des Alltags, begabte Zeichnerin psychologisch stimmiger Porträts“), vom Stück („hervorragende Studie einer Familie ...“) und nicht zuletzt von Darstellern und Regie („beeindruckende Umsetzung“).
Endlich, nach gut 12 Jahren Loher-loser Zeit, hatte jetzt im Grabbe-Haus ihr neuestes Stück Premiere: „Am schwarzen See“, Ende 2012 von Andreas Kriegenburg (der auf Loher-Uraufführungen quasi abonniert ist) erstmals am Deutschen Theater Berlin inszeniert, dann zum Heidelberger Stückemarkt eingeladen, nachgespielt in Hannover, Kiel, Göttingen ...
Wieder (wie so oft bei Loher) geht es um eine Facette im Verhältnis Eltern – Kinder, hier um die vielleicht schmerzlichste Facette: der Verlust des Kindes durch Selbstmord! Das ist in Deutschland gar nicht so selten, wie im Detmolder Programmheft ausführlich nachzulesen ist.
Die Geschichte: zwei Ehepaare am See
Der Titel nennt den Ort des Geschehens: „am Schwarzen See“. An dessen Ufer betreiben Cleo und Eddie eine kleine Brauerei, die sich wohl so gerade über Wasser hält. Sie bekommen Besuch von Johnny und Else, alten Freunden, die früher mal hier gewohnt haben und jetzt auf dem Weg an die Küste einen Zwischenstopp einlegen. Das Stück springt mitten hinein in eine hektisch-begeisterte Begrüßung: lauter Phrasen, von denen keine zu Ende gesprochen wird – bis am Ende der kurzen ersten Szene endlich ein kompletter Satz steht: „Da draußen liegt der See, der Schwarze See – seht nur -, wie immer.“
Stichwort für eine Rückblende: Man erinnert sich ausgiebig an das erste Treffen hier, am Schwarzen See, vor vermutlich sechs Jahren: wie man sich damals zunächst distanziert beschnupperte, wie dann das Eis gebrochen wurde durch eine ausgelassen-fröhliche Bootsfahrt, wie man sich nahe gekommen ist („Das war der Abend, an dem wir alle miteinander .... beinahe ...“). Man lacht viel, beschwört die lustige Stimmung von damals herauf, lacht noch mehr ... Und doch ...!
Nicht nur die sauertöpfische Distanziertheit, mit der Johnny das aufgekratzte Treiben der andern missbilligt, weckt den Verdacht, dass hier etwas nicht stimmt. Nein, es ist offensichtlich: die fast schon peinliche Lustigkeit ist gespielt; die geradezu krampfhaft zelebrierten schönen Erinnerungen sollen von etwas anderem ablenken, sollen etwas verdrängen, was sich nicht verdrängen lässt. Und so kommt bald doch ans Licht, was wirklich die Gemüter bewegt: ein anderer Gang zum See, vor vier Jahren, wieder „allein zu viert“ – doch diesmal hatte das „allein“ eine tragische Bedeutung: jetzt gingen die vier zum See, um die Leichen ihrer Kinder aus dem Wasser zu bergen. Die 15jährigen, ein Liebespaar, hatten sich gemeinsam umgebracht und den Eltern lediglich die rätselhafte Nachricht hinterlassen: „WIR GEHEN JETZT – DAS HIER IST NICHT SCHÖN – DIE LIEBE IST DER TOD – DER TOD IST DIE LIEBE“.
Das lange Elend des Verlusts
Der lange Rest des Abends ist dem Bemühen gewidmet, mit diesem Verlust fertig zu werden, die Erinnerungen zu ertragen und vor allem: über das „Warum?“ zu rätseln. Natürlich bleibt das Bemühen vergeblich; natürlich sind die Erinnerungen unerträglich; und natürlich bleibt die Frage nach der Ursache unbeantwortet. So müssen sich die verwaisten Eltern weiter mit der Überlegung herumschlagen, wie groß ihre eigene Schuld an der Tragödie war, was sie falsch gemacht hatten, ob sie etwas hätten ändern können ...
Schwere Kost, wie gesagt. Und – anders als etwa in „Tätowierung“ – gibt es keinen Handlungsfaden, keinen dramaturgisch zielgerichteten Ablauf. Nur nicht aufhörendes Wiederkäuen des Elends, so unerträglich, dass das Premierenpublikum schon nach drei Vierteln des Stücks zum erleichtert-energischen Schlussapplaus ansetzt (später gab’s dann noch den redlich verdienten ausführlichen und kräftigen Beifall für Darsteller und Regieteam). Und das alles in einer zerhackten Sprache: mit ständigen Themenwechseln, dauernden Wiederholungen, ewig nicht zu Ende gebrachten und von „Schweigen“ unterbrochenen Sätzen (wobei der Verzicht Lohers auf jegliche Interpunktion der Regie einen weiten Gestaltungsrahmen lässt).
Berührender Text - vorzügliche Regie
Um so wichtiger: die Konzentration auf die einzelne Szene, die feine psychologische Zeichnung der Figuren. Und beides beherrscht Dea Loher hervorragend; beides wird in Martin Pfaffs Regie vorzüglich umgesetzt. Natürlich treten mal alle vier gemeinsam auf. Aber es überwiegen die (verstohlenen) Dialoge, die (entlarvenden) Monologe. Da gibt es witzige Szenen (selten), groteske (häufiger) und trostlose (meist); es gibt erzählende Passagen (wo’s nötig ist) und rätselhafte (immer wieder): so wird nie ganz klar, was für ein Verhältnis Eddie und Else haben/hatten, und warum der Umstand, dass die tote Nina ihrer Mutter Else „so wahnsinnig ähnlich sieht“, Eddie daran hindert, ein Foto von ihr aufzuhängen. Aber wie auch immer: es gibt kaum eine Szene, die den Zuschauer nicht berührt, nicht mitnimmt!
Die Personen - vier phänomenale Darsteller
Das ist natürlich auch den phänomenalen Darstellern zu verdanken! Pia Wessels hat sie in Kostüme gesteckt, die die Alltäglichkeit der vier zum Ausdruck bringen – und durch kleine Auffälligkeiten (Elses bunte Kunstpelzjacke, Eddies kurze Hosen) allenfalls eine vage Exzentrität ahnen lassen. Joachim Ruczynski zeigt mal wieder seine Kunst, mit feinen Gesten, mit leisen Nuancen einen vielschichtigen Charakter zu zeichnen – hier Johnny, den leitenden Bankangestellten, der „auch nicht immer derselbe“ ist. Kerstin Klinder ist Else, die herzkranke Frau, die sich nicht aufregen darf, und genau das immer tut, bis hin zur Aggressivität (auch gegen sich selbst: in Lohers Text ritzt sie sich; auf der Detmolder Bühne wird das nicht erkennbar). Stephan Clemens zeigt mit viel Einfühlungsvermögen einen Eddie, der Probleme am liebsten verdrängt, der allen Seelenmüll entsorgen möchte, und – da das nun mal nicht geht – sich wenigstens seiner materiellen Güter entledigt und sie verschenkt, einschließlich der Wäsche und neugekaufter Möbel. Seine Frau Cleo beschimpft ihn dafür als „Bettelmönch“ und „heiliger Idiot“ und kümmert sich lebenspraktisch darum, dass das Geld reinkommt, dass die Brauerei nicht pleite geht. Doch natürlich schafft es Ewa Rataj, immer wieder die Verzweiflung durchscheinen zu lassen, die hinter dieser Fassade der Tüchtigkeit brodelt.
Bemerkenswertes Bühnenbild
Die Berliner Uraufführung zeigte ein beinahe naturalistisches Bühnenbild: ein Wohnzimmer im Stil einer Berliner Altbauwohnung – nach außen abgekapselt, das Fenster (zum See?) vermauert (aber eine perfekte Projektionsfläche für das Bild, das sich die Protagonisten vom todbringenden Gewässer machen). Ganz anders in Detmold! Noch besser! Erik Schimkat hat auf die kleine Bühne eine Bretterbude gestellt, die nach allen Seiten offen ist (den See müssen wir uns wohl im Zuschauerraum vorstellen). Die einfache Konstruktion macht das Haus flexibel, beweglich. So dass die Bewohner keinerlei Mühe haben, es im Lauf des Abends in Stücke zu zerlegen. Allzu plattes Symbol dafür, wie vier Leben in die Brüche gehen, am Boden zerstört sind? Nein – ganz so einfach ist es doch nicht! Denn am Schluss bauen sie das Haus wieder auf. Das Leben ... das Elend muss weitergehen! Immer wieder während des (sich wohl über mehrere Tage hinziehenden Aufenthalts) hat Johnny angekündigt: Morgen wollen wir weiter. Übermorgen wollen wir weiter. „Schon lange wollten wir morgen weg“. Doch am Schluss steht Cleos Aufforderung: „Bleibt doch einfach hier.“ – Das Elend muss weitergehen!
Die Hölle
Fast fühlt man sich da zurückversetzt in Sartres „geschlossene Gesellschaft“, vor nicht allzu langer Zeit in diesem Haus: Es ist die Hölle, die nie endet! Irgendwo in Lohers Text heißt es: „Das ist Limbo“ (ist dieser Satz in Detmold gestrichen? Oder habe ich ihn nur überhört?). „Limbo“ – in der katholischen Theologie (und in Dantes „Göttlicher Komödie“) bezeichnet das den ersten Kreis der Hölle, die Vorhölle, wo die Seelen gefangengehalten werden, die ohne eigenes Verschulden vom Himmel ausgeschlossen sind. Der wohl berühmteste Satz aus Sartres Stück über die ewige Verdammnis drängt sich geradezu auf: „Die Hölle – das sind die anderen“.
Am Schwarzen See
Schauspiel von Dea Loher
Regie: Martin Pfaff
Bühne: Erik Schimkat
Kostüme: Pia Wessels
Dramaturgie: Christian Katzschmann
Johnny: Joachim Ruczynski
Else: Kerstin Klinder
Cleo: Ewa Rataj
Eddie: Stephan Clemens
Weitere Vorstellungen:
Mo 27.01.
Mo 03.02.
Fr 14.02.
Sa 15.02.
Mo 17.02.
Di 25.02.
Sa 15.03.
So 30.03.
So 13.04.
So 27.04.2014