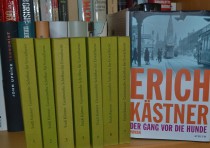„Jugend ohne Gott“
Mittelmäßiger Roman anstelle eines guten Stücks
Landestheater bringt Horváths Roman auf die Bühne
Der Autor und seine Stärken
Ödön von Horváth (1901 – 1938) ist neben Brecht (1898 – 1956) der bedeutendste Dramatiker der Zeit zwischen den Weltkriegen. Er begann mit politischen Stücken, in denen er mit erschreckend klarer Voraussicht vor dem Aufkommen des Faschismus warnte („Sladek der schwarze Reichswehrmann“, 1929, „Italienische Nacht“, 1931, u.a.); später verfiel er einem seltsamen, mystisch angehauchten Irrealismus, mit dem wir Heutigen nicht mehr viel anfangen wollen (z. B. „Der jüngste Tag“, 1937). Doch dazwischen liegen seine so genannten „Volksstücke“, und die gehören (auch wenn das jetzt sehr hochgestochen klingen mag!) zum Besten, was es an deutschsprachiger Theaterliteratur seit Goethes Faust und Schillers großen Dramen gibt, z. B. die Oktoberfest-Ballade der kleinen Leute „Kasimir und Karoline“ (1932) und allen voran die wunderbaren „Geschichten aus dem Wiener Wald“ (1931).
Angesichts dieser Horváth-Begeisterung hätte ich mich ja wirklich freuen müssen, dass das Landestheater in der Saison 2021/22 einen Horváth-Text auf die Bühne bringt. Wer aber meine geradezu penetrante Ablehnung von Roman-Dramatisierungen kennt, wird verstehen, dass ich um so enttäuschter war, dass es sich bei diesem Text um „Jugend ohne Gott“ handelt – also einen Roman! Und noch nicht mal einen allzu guten!
Die Story
Der Roman – die mit Reflexionen durchsetzte Erzählung eines jungen Lehrers - spielt wohl ungefähr in der Entstehungszeit des Textes, 1936/37. Die Jugend soll autoritär-militaristisch-national-rassistisch erzogen werden. Vorsichtige Versuche des Lehrers gegenzusteuern, werden unterbunden. In einem Wehrsport-Zeltlager wird der Schüler N ermordet; Schüler Z hat sich verdächtig gemacht und wird angeklagt. Der Lehrer spürt eine moralische Mitschuld an dem Mord, hat Gewissensbisse: Soll er die Wahrheit sagen und damit seine sichere Lehrerstelle riskieren? Der ursprünglich gottferne Lehrer hört schließlich auf die Stimme Gottes und sagt vor Gericht aus, was letztlich zur Entlastung des Z führt. Der Lehrer verdächtigt zurecht T als den eigentlichen Mörder und setzt ihn dermaßen unter Druck, dass der schließlich gesteht und sich umbringt. Der Lehrer hat zwar seine Stelle verloren, doch ein Pfarrer ist von seiner Wahrheitsliebe so beeindruckt, dass er ihm eine Lehrerstelle an einer Missionsschule in Afrika verschafft.
Vom Roman zum Bühnenstück
Anstatt nun endlich mal wieder eines von Horváths sehr guten „Volksstücken“ zu spielen („Kasimir und Karoline“ war zuletzt 1999 in Detmold zu sehen, der „Wienerwald“ nach meiner Erinnerung nie), oder (wenn‘s denn „politisch“ sein soll!) anstatt eines seiner gleichfalls guten frühen Stücke hervorzukramen – anstatt dessen vergibt man also an Benedikt Grubel den Auftrag, den Roman „Jugend ohne Gott“ zu dramatisieren.
Und schon sind wir wieder bei den üblichen Vorwürfen: Auf dem Weg vom Roman auf die Bühne geht in aller Regel viel Inhalt verloren. Z. B. wird unterschlagen, dass ein Schüler an Lungenentzündung stirbt, ebenso ein Komplott gegen den verdächtigen T. Aber das mag verzichtbar sein. Problematischer ist, dass die Gewissensentscheidung des Lehrers an Gewicht verliert, u. a. dadurch dass die Eltern des Lehrers stark in den Hintergrund gedrängt werden, wobei sie – auf den Unterhalt durch ihren Sohn angewiesen – doch eine wichtige Rolle für dessen Entscheidung zwischen Wahrheit einerseits und sicherer Stelle mit Pensionsberechtigung andererseits spielen.
Von den Kürzungen abgesehen hält sich Grubel allerdings sehr eng an Horváths Text. Die – bis lange nach Horvaths Zeiten – übliche Bezeichnung für einen schwarzen Afrikaner (das berüchtigte „N*-Wort“ also) hat er jedoch durch „Afrikaner“ ersetzt – was die ursprüngliche Stimmung überhaupt nicht wiedergibt. (Inwieweit alte Texte vermeintlich „politisch korrekt“ umgeschrieben werden sollen und welche dadurch verursachten Verfälschungen des Textes akzeptabel sind, bedürfte einer ausführlichen Diskussion.)
Dagegen eine eher amüsante Abweichung: Wenn der rechtsradikale Vater dem Lehrer droht: „Bei Philippi sehen wir uns wieder!“, so wird dies umgedeutet in „beim Direktor sehen wir uns wieder“ und der Direktor flugs „Philippi“ genannt. Will Grubel damit andeuten, dass er diese Redewendung dem biederen Bäcker nicht zutraut? Oder glaubt er, dass seine Zuschauer nichts damit anfangen können? (Dass die Theaterleute selbst das – auf Plutrach zurückgehende – Zitat aus Shakespeares „Julius Cäsar“ nicht kennen sollten, mag ich nun gar nicht glauben.)
Ein weiterer Vorwurf: Dass epische Texte oft einfach nicht für eine Spielhandlung geeignet sind. Zeigt sich das auch bei der vorliegenden „Dramatisierung“?
Aber was heißt da „Dramatisierung“?
Textaufsagen mit verteilten Rollen – die Inszenierung
Grubel begnügt sich im Wesentlichen damit, den Text in zahlreiche Häppchen aufzuteilen und mit verteilten Rollen aufsagen zu lassen.
Aber was heißt hier „verteilte Rollen“?
Fast scheint, man habe die Darsteller-innen genommen, die grad frei waren und den Text ziemlich beliebig auf sie aufgeteilt, ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht. Immerhin bringt Natascha Mamier den Feldwebel überzeugend rüber: einerseits bärbeißig, andererseits „als alter Soldat für den Frieden“. Und wie Jürgen Roth einen gutmütigen Direktor spielt, welcher einen wütend-tobenden Direktor spielt, das hat schon ein Lob verdient: „Ein guter Schauspieler“ (steht so schon bei Horváth). - Dass die – eigentlich – reine Jungen-Klasse zu einem Drittel aus Frauen und umgekehrt die Mädchen-Kompanie zu zwei Dritteln aus Männern besteht – geschenkt. Aber man fragt sich schon, wieso der Lehrer (Justus Henke) viel jugendlicher wirkt als die meisten seiner Schüler; und wieso die Mutter des Angeklagten (eine „Frau Professor“ mit einem „unangenehmen Organ“ und Neigung zu Hysterie) mit Stimme und Kleidung (Minirock) eines jungen Mädchens auftritt.
Apropos Minirock: Auch die Kostüme wirken ziemlich willkürlich zusammengestellt. Der – von einer jungen Frau gespielte – alte Pädophile Cäsar wirkt ein bisschen wie der Nonkonformist Huckleberry Finn – was durchaus passt. Aber sonst werden Charaktere kaum durch Kleidung akzentuiert (wie auch? - wo doch fast alle mehrere Rollen auszufüllen haben).
Episches Theater?
Wohlmeinende mögen diese Spielweise als episches Theater im Sinne Brechts interpretieren – was von der Regie insofern unterstützt wird, als sie mal ein „Glotzen Se nicht so romantisch“ einfügt. - „Glotzt nicht so romantisch“ (aus „Trommeln in der Nacht“) ist die fürs epische Theater emblematisch gewordene Aufforderung Brechts an die Zuschauer, sich nicht von einer Handlung mitreißen zu lassen, sich schon gar nicht Gefühlen hinzugeben, sondern vielmehr einer Erzählung kritisch-beobachtend zu folgen, um Erkenntnis zu gewinnen und im Idealfall für eine bessere Welt aktiv zu werden (ja, ich weiß, das ist sehr verkürzt!).
Los, Publikum, such dir selbst den Schluss!
Da stellt sich dann die Frage: Auf welche Erkenntnis zielt diese Inszenierung? – Mit anderen Worten: Warum sollte es dieser Text in dieser Zeit sein? Um die historische Erkenntnis, dass das Nazi-Regime die Jugend massiv indoktriniert hat, wird es wohl nicht gehen. Nach Klaus Kastberger ist der Roman „als Kriminalgeschichte oder als Bekehrungsgeschichte lesbar“. Also Krimi? Nein, zu banal. Und die Bekehrungsgeschichte? Ist schon im Roman äußerst fragwürdig; in der Detmolder Bühnenfassung tritt sie zudem ziemlich in den Hintergrund.
Das „Jugend ohne Gott“ der 30er Jahre würde man heute vielleicht übersetzen in: Jugend ohne Moral, Jugend ohne Werte. Soll der heutigen Jugend dieser Spiegel vorgehalten werden? Ausgerechnet jetzt, wo sich Tausende für die Zukunft der Welt, also: für Werte engagieren und auf die Straße gehen? – Oder gerade jetzt, wo es (bei der Bundestagswahl) neben dem „grünen“ Drittel der Jungwähler auch ein „FDP-Drittel“ gab, also Anhänger der (faktisch immer noch, auch wenn sie’s nicht mehr so gern hören) „Partei der Besserverdienenden“, also der Bewahrer des wirtschaftlich-sozialen Status-Quo mit all seinen Ungleichgewichten und Ungerechtigkeiten?
Der Beitrag von Dramaturgin Laura Friedrich im Programmheft deutet in diese Richtung. Demnach geht es in Grubels Bühnenadaption um die Frage, „inwiefern es möglich ist, sich von einer Gesellschaft, in der man lebt, und somit von einer Ideologie, mit der man gezwungenermaßen in Berührung kommt, zu distanzieren. Das ist eine Frage, die sich auch in unserer globalisierten und hochgradig vernetzten Welt stellt“.
Bedenkenswerte Fragen, ganz gewiss! Antworten darauf gibt’s jedoch nicht. Aber das muss ja auch nicht Aufgabe des Theaters sein. Erst recht nicht des epischen Theaters. Da hat Brecht am Ende seines Lehrstücks über einen „guten Menschen“ anstelle einer Antwort eine (Auf-) Forderung gestellt:
„Der einzige Ausweg wär aus diesem Ungemach.
Sie selber dächten auf der Stelle nach
Auf welche Weis‘ dem guten Menschen man
Zu einem guten Ende helfen kann.
Verehrtes Publikum, los, such dir selbst den Schluss!
Es muss ein guter da sein, muss, muss, muss!".
Jugend ohne Gott
Schauspiel nach dem Roman von Ödön von Horváth
Regie: Benedikt Grubel
Ausstattung: Anna Brandstätter
Musik: Jan Paul Werge
Dramaturgie: Laura Friedrich
Maske: Kerstin Steinke
Licht: Carsten-Alexander Lenauer
Ton: Timo Hintz
Darsteller:
Stella Hanheide
Patrick Hellenbrand
Justus Henke
Kerstin Klinder
André Lassen
Natascha Mamier
Ewa Noack
Johannes Rebers
Jürgen Roth