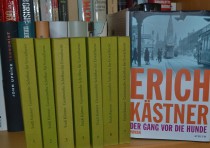Zeitloser Verfall: "Die Ratten"
Berliner Tragikomödie von Gerhart Hauptmann am Landestheater
WaSa - Detmold. Eine Pastorentochter war Angestellte „in einem adligen Hause“. Dort ließ sie sich schwängern „und als sie im Elternhause Zuflucht suchte, stieß ihr Vater, triefend von Christentum, sie vor die Tür.“ In der Folge landet sie – vermutlich – in der Prostitution und endlich auf einem Selbstmörderfriedhof. – Auch Sidonie Knobbe wird zur Prostituierten und Drogenabhängigen, als ihr „adelsstolzer Herr Vater sie verstieß, nachdem sie als junges Ding einen Fall getan hatte“.
Eine schwangere polnische Hausangestellte (Anna Katharina Schwabroh) wird von ihren Lieberhaber sitzengelassen und sieht die Konsequenzen
voraus: sie wird Anstellung und Unterkunft verlieren; „Vater haut mir Kopf an die Wand und schmeißt mir Straße“; lieber „spring ick im Landwehrkanal und versaufe“. Zum Glück bietet die
kinderlose Frau John (Ewa Rataj) an, ihr das heimlich zur Welt gebrachte Kind abzunehmen – was jedoch letztlich dazu führt, dass eine leidlich funktionierende Ehe zerbricht, weil der vermeintliche
Vater „uff’n Ehrenpunkt kitzlich ist“. So liegt am Ende nicht nur die unglückliche leibliche Mutter tot da, sondern auch die Pflegemutter. Und auch das Schicksal des Kindes ist vorgezeichnet: es
kommt in eine dubiose Pflege, und da „sterben von’s Dutzend mehrschtens zehn.“
All diese (klein-)bürgerlich-proletarischen Tragödien hat Gerhart Hauptmann in seinen „Ratten“ versammelt. Entstanden ist das Drama in den Jahren 1909 – 1910. Damals waren solche Geschichten
glaubwürdig, um nicht zu sagen: an der Tagesordnung.
Aber heute?
Welche ungewollt schwangere Hausangestellte würde heute in den Landwehrkanal springen? Welcher Vater – und sei es ein hochmoralischer Pastor – sollte seine schwangere Tochter dem Elend überlassen,
nur um eine verstaubte Familienehre rein zu halten?
Etwa zu der Zeit, als in Detmold die Proben zu den Ratten begannen und in etwa drei Kilometer Entfernung vom Landestheater wurde eine junge Frau von ihren Geschwistern entführt, weil sie nach den
Begriffen der Familie in einem unehrenhaften Verhältnis lebte. Wenige Tage vor der Premiere wurde ihre Leiche gefunden. Natürlich war das keine „deutsche“ Familie, sondern eine kurdisch-jesidische.
Aber sie galt als integriert. Und vielleicht bleibt ja von einem soeben abgetretenen Präsidenten nicht nur das Verb „wulffen“ bestehen, sondern auch die Erkenntnis, dass der Islam (oder eben
das Jesidentum) inzwischen zu Deutschland gehört, und dass wir uns wohl oder übel mit Kulturelementen auseinandersetzen müssen, die so gar nicht in unser aufgeklärtes Zeitalter passen wollen.
Insofern wirkt die Detmolder Ratten-Inszenierung keinesfalls verstaubt – was natürlich nicht nur mit dem unglückseligen aktuellen Ereignis zu erklären ist, sondern vor allem mit dem
Geschick des Regieteams um die Detmolder Spielleiterin Tatjana Rese und mit den soliden Leistungen des (beinahe gesamten) Schauspiel-Ensembles.
Die Detmolder „Ratten“ spielen in einem Einheitsbühnenbild. Das ist durchaus angemessen, da es für die einzelnen Szenen letztlich egal ist, ob sie sich in Direktor Hassenreuters
Theaterfundus im Dachgeschoss abspielen oder eine Etage tiefer in der Johnschen Wohnung. Von Hassenreuters „Motten-, Ratten- und Flohparadies“ ist hier allerdings kaum etwas übriggeblieben. Die
Holzstühle, die zunächst das Bild beherrschen, gehören der Familie John; an den Theaterkrempel erinnert höchstens ein altes Waldhorn. Allerdings tauchen Requisiten wie aus dem Nichts auf, sobald sie
benötigt werden – sei es ein Bärenkopf, die Papenheimschen Brustharnische oder die Ausstattung der Heiligen Drei Könige, als die sich Hassenreuters Schauspielschüler ausstaffieren, um dem
neugeborenen Kind zu huldigen.
Und vorne spielt sich also – unter anderem – die Tragödie der verhinderten Mutter John ab.
Hervorragend dargestellt durch Ewa Rataj, die den Zuschauer auf geradezu schmerzliche Weise miterleben lässt, wie diese tatkräftig-praktische Frau Ängsten um „ihr“ Kind ausgesetzt wird und so zur gehetzten Kidnapperin und schließlich zur elend-verzweifelten Selbstmörderin wird.
Auf Augenhöhe mit ihr agiert Markus Hottgenroth als Theaterdirektor. (Der hat übrigens vor gut 10 Jahren in Detmold den jungen Spitta gespielt, den idealistischen
Theater-Erneuerer, in dem sich Hauptmann wohl selbst gespiegelt hatte.) Jetzt gibt Hottgenroth ein sehenswertes etabliertes Theaterfossil mit bildungsbürgerlichem Gehabe, allerdings auch mit einigen
seltsamen Facetten. Zwar ist sein deutsch-nationales Loblieb auf Bismarck weitgehend gestrichen. Dafür verfällt er – ausgerechnet als er den Milchapparat für das Baby anpreist – in einen so
zynisch-schneidenden Duktus, dass man fast meinen könnte, hier sei ein SS-Bonze dabei, so eine arme kleine Mizzi zu massakrieren.
Darüber hinaus tun die Detmolder einiges, diese zeitlose Geschichte um menschliches (mehr noch geistiges als materielles) Elend aus der Periode kurz vor dem Ersten Weltkrieg
herauszuholen – unter anderem durch eine Art Chor von beinahe Brechtscher Prägnanz: Das Goethe-Schiller-Weimarsche Pathos, mit dem Hauptmanns Theaterdirektor seine Schauspielschüler die
„Braut von Messina“ deklamieren lässt, wird von Rese immer häufiger ergänzt durch Gesänge aus dem so vielseiten deutschen Liedgutschatz. Da wird die Hoffnung auf ein Ufa-Happy End mit dem Lied vom
„kleinen bisschen Glück“ heraufbeschworen; allerdings haben da die Böhsen Onkelz längst klar gemacht: „dies ist ein dunkler Ort, weil du ihn dazu machst!“ Dass der Chor auf den Tod des polnischen
Dienstmädchens ausgerechnet mit dem Landserlied vom Polenstädtchen reagiert, mag man – je nach Sensibilität – als passenden Kommentar oder als Geschmacklosigkeit empfinden.
Fazit:
Eine gut gemachte und spannende Inszenierung, auch wenn man – trotz beträchtlicher Kürzungen – ein paar Längen empfindet. Ein immer wiederkehrender Kritikpunkt: Der Text war manchmal schwer verständlich. Das lag weniger an den zahlreichen Dialekten (von Berlinerisch über Wienerisch bis zum polnischen Akzent) – die wurden von den Schauspielern mit beachtlicher Bravour gemeistert. Aber wenn Dialekt und schnelles Sprechen (wie einige Male bei Frau John) und womöglich noch undeutliches oder nach hinten gerichtetes Sprechen zusammenkommen – dann hat man eben doch Verständnisprobleme, erst recht, wenn mit zunehmendem Alter das Gehör nachlässt. Beim Neujahrsempfang hat der Detmolder Intendant so manchen Grauhaarigen massiv verärgert, als er davon sprach, von der Bühne blicke man ins Parkett wie auf einen Silbersee. Aber vielleicht sollten die Verantwortlichen gelegentlich auch an die besonderen Bedürfnisse dieser – nun mal treuesten – Kundschaft denken.
Regie: Tatjana Rese
Bühne und Kostüme: Pia Wessels
Dramaturgie: Dr. Christian Katzschmann
musikalische Leitung und Einrichtung: Ute Haußner-Unger
Harro Hassenreuter, ehemaliger Theaterdirektor: Markus Hottgenroth
Walburga, seine Tochter: Jenny-Ellen Riemann
Pastor Spitta, Vater von Erich Spitta: Jörg Miethe
Erich Spitta, Kandidat der Theologie, sein Sohn: Robert A. Augustin
Käferstein, Schüler Hassenreuters: Joachim Ruczynski
Dr. Kegel, Schüler Hassenreuters: Jürgen Roth
Herr John, Maurerpolier: Stephan Clemens
Frau John, seine Frau, Putzkraft bei Hassenreuter: Ewa Rataj
Bruno Mechelke, ihr Bruder: Martin Krah
Pauline Piperkarcka, Dienstmädchen: Anna Katharina Schwabroh
Frau Sidonie Knobbe: Friederike Ziegler
Selma, ihre Tochter: Melanie Tóth
Quaquaro, Hausmeister: Philipp Baumgarten