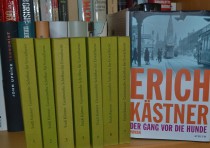Verkorkste Feier - grandioses Fest
"Das Fest" als beeindruckendes / bedrückendes Zeit-Stück
Vom Dogma-Film zum Bühnenereignis
g.wasa - Detmold - Helge, ein etablierter und wohl beleumdeter Hotelbesitzer, feiert seinen 60. Geburtstag, und alle kommen gerne, "wenn die Familie Klingenfeldt-Hansen in gewohnter Üppigkeit zum geselligen Beisammensein einlädt".
Die Geschichte dieser Familienfeier haben zunächst Vinterberg / Rukov in einem "Dogma"-Film erzählt. Burkhard C. Kosminski hat daraus ein Theaterstück gemacht und sich bei der Uraufführung (1999 in Dortmund) bemüht, die Dogma-Prinzipien ("natürliches" Kino ohne technische Hilfsmittel und künstliche Zutaten) an Theaterverhältnisse anzupassen: indem die Zuschauer mit auf der Bühne gesetzt wurden, quasi in Tuchfühlung mit den handelnden Personen. Wenig später, in der Dresdner Inszenierung durfte/musste das Publikum sogar mit an der großen Geburtstagstafel Platz nehmen und bekam das Festessen serviert.
Inzwischen hat sich „das Fest“ als eines der wirkmächtigsten Stücke der jüngeren Theatergeschichte erwiesen, wurde von zahlreichen Theatern nachgespielt, in der Regel auf die übliche Weise, mit den Zuschauern unten, den Darstellern oben. So jetzt auch in Detmold. Hier wurde die „Fest“-Premiere genutzt, vor dem Aufgehen des Vorhangs den diesjährigen „Christian Dietrich Grabbe-Preis“ zu verleihen. Somit verlängerte sich das Lampenfieber des hinter dem Vorhang wartenden Ensembles noch um eine halbe Stunde – worauf Intendant Metzger mitfühlend hinwies, bevor er mit einem Goethe-Zitat die Bühne freigab:
„Die Pfosten sind, die Bretter aufgeschlagen,
Und jedermann erwartet sich ein Fest“.
Die später im Text folgende Aufforderung an die Mitwirkenden konnte er sich sparen – das würde sich schon von selbst ergeben:
„So schreitet … mit bedächt’ger Schnelle
Vom Himmel durch die Welt zur Hölle.“
Verkorkste Familienfeier
Es ist so eine Sache mit Familienfesten. Wie oft benimmt sich jemand daneben. Wie oft beginnt man in himmlischer Eintracht und endet mit höllischem Streit. Natürlich hat man auch für Helges Geburtstag beste Absichten, ist wild entschlossen, diesen Abend zu genießen. Das klappt soweit auch ganz gut, das Fest droht zu einem Erfolg zu werden. Bis Christian, der älteste Sohn, aufsteht und der erwartungsfrohen Festgesellschaft mit viel Liebe zum grässlichen Detail schildert, wie er und seine Zwillingsschwester vom guten Vater regelmäßig vergewaltigt wurden. Er braucht mehrere Anläufe, um durchzudringen, aber am Ende stehen wir vor dem familiären Scherbenhaufen. Also doch kein Fest, allenfalls ein gründlich verkorkstes!
Grandioses Theaterfest
Aber es gibt dann eben auch noch ein gelungenes Fest - ein grandios gelungenes Fest für Theater und Publikum! Eine herrlich gelungene Aufführung! (Es sei vorweggenommen: am Schluss hat das Premierenpublikum lange und kräftig applaudiert. Mit Recht!)
Der schöne Schein
Das liegt zunächst an dem Stück und den Möglichkeiten, die es bietet. Dabei geht es gar nicht unbedingt um das schreckliche Thema Inzest und Missbrauch - davon könnten sich viele, da nicht betroffen, einfach distanzieren. (Oder? – siehe unten.) Womöglich genauso schlimm, wie die Tat selber, ist die routinierte Gleichgültigkeit, das verbreitete Bestreben, den schönen Schein zu wahren, die hohe Kunst der Verdrängung. Eine der Stärken des Stückes ist die psychologisch-differenzierte, die drastische und zugleich anrührende Darstellung der Reaktionen auf das Eindringen des Unsäglichen in die Wohlanständigkeit. Da ist zunächst das sture Ignorieren. Da ist der schlichte Fluchtreflex der Verwandten („Ich will nach Hause“) und das schiere Nichtverstehen-Können/-Wollen des Großvaters. Da ist der Versuch des Vaters, sich durch einen brutalen Gegenangriff zu befreien; und der viel subtilere und viel grausamere Gegenangriff der Mutter, die den Sohn in liebevollem Ton und verpackt in einem Kompliment (Du hättest „ein richtig guter Schriftsteller“ werden können) als pathologischen Lügner brandmarkt. Schließlich die körperliche Aggressivität des Bruders gegen den Störenfried. Dazu kommt eine raffinierte Dramaturgie, die das "Fest" recht harmlos beginnen lässt, aber schon früh Schatten erahnen lässt, die sich immer mehr verdichten, das heitere Bild immer mehr verdüstern bis es - als hätte E. A. Poe Regie geführt - zum Horrorszenario im bürgerlichen Festgewand wird.
Die Detmolder Inszenierung
In Detmold wurde der Text stark gekürzt. Dem kann man stellenweise zustimmen (wenn der Opa seine leicht anrüchige „Geschichte von den sieben Meeren“ keine dreimal erzählen muss - Henry Klinder kriegt es problemlos hin, die Senilität des Alten schon beim ersten Mal überzeugend zu vermitteln). Aber insgesamt hätte man sich schon etwas mehr gewünscht. Im Originaltext dauert die Zertrümmerung der Familienidylle etwa anderthalb Tage. In Detmold hat man fast den Eindruck, die Erzählzeit von knapp anderthalb Stunden entspreche der erzählten Zeit. Der Zusammenbruch der gutbürgerlichen Wohlanständigkeit verläuft hier doch recht schnell und wirkt dadurch chaotischer als im Original. - Manchmal lässt eine Zutat der Detmolder Regie aufmerken: wenn es diese braven Bürger nicht beim gegrölten rassistischen Kinderlied bewenden lassen („Zehn kleine Negerlein“ ist ein gut gewählter Ersatz für das dänische Original), sondern sich an der eigenen weißen Überlegenheit so berauschen, dass sie über „Zicke! Zacke!“ ganz schnell bei „Sieg! – Heil!“ landen.
Tolles Ensemble
Auch das Personal ist radikal reduziert. Bis auf den „Toast-Master“ (überzeugend: Jürgen Roth) sind alle gestrichen, die nicht zur engeren Familie gehören (stattdessen versucht man immer mal wieder, das Theaterpublikum in den Kreis der Gäste einzubeziehen). Selbst bei der Familie wurde gekürzt: keine Enkelin, die sich mal dem Opa auf den Schoß setzt. Und vor allem: keine tote Tochter, die gegen Ende als Gespenst erscheint.
Auch so ist gespenstisch genug, was da abläuft! Auch dieses "Fest" bleibt eine beeindruckende und bedrückende Studie aus dem bürgerlichen Familienleben. Dazu wird es auch durch großartige Schauspielerei. Zum Beispiel von Hubertus Brandt, der die gewiss schwierige Rolle des prollig-anmaßenden Sohnes (in der Detmolder Fassung – nachvollziehbar - als „Arschloch“ eingeführt) souverän meistert. Jedes Zimmermädchen ist hier ein Charakter! Der beliebte Theaterspruch "Der Star ist das Ensemble" gilt in dieser Inszenierung uneingeschränkt.
Und doch müssen drei Darsteller ob ihrer exzellenten Leistung hervorgehoben werden: Kerstin Klinder als die gute Familienmutter, die um jeden Preis beharrlich an ihrer Lebenslüge festhält.
Und natürlich Gustav Peter Wöhler, der als prominenter Gast den Anti-Helden Helge „vom Himmel zur Hölle“ führt: vom erfolgreich-selbstbewussten und jovial-selbstgefälligen Patriarchen zum verachteten Schwein – das am Ende aber doch nicht nur Ekel, sondern auch ein bisschen Mitleid weckt.
Und endlich Markus Hottgenroth als Christian: zu Beginn der erfolgreiche Geschäftsmann ("der hat zwei Restaurants in Paris") und gute Sohn. Dann Störenfried, der angesichts der ihm entgegenschlagenden Hasswelle immer wieder in alkoholgetränkte depressive Verzweiflung verfällt, und sich doch immer wieder aufrafft und seinen Kampf fortsetzt – bis zum endlichen Sieg, ohne dass er diesen Sieg tatsächlich zu genießen vermöchte.
Happy End?
Ungefähr als die Detmolder „Fest“-Proben begannen, hat „#Me too“ die Übergriffigkeit vieler einflussreicher „Patriarchen“ in bisher kaum vorstellbarem Umfang thematisiert. Seit das Stück 1999 erstmals gespielt wurde, sind zahlreiche Kinderschänder-Skandale in Heimen, in Schulen, in kirchlichen Einrichtungen ans Licht gekommen. Am Tag nach der Detmolder Premiere berichtet der SPIEGEL unter dem Titel „GeilerDaddy“ von dem Freiburger Jungen, der von Mutter und Stiefvater nicht nur selbst missbraucht, sondern übers Internet an ganze Kinderschänderhorden verschachert wurde. Gerade hier, „im Schoß der Familie“, den man als ganz besonders geschützten Raum vermuten möchte, ist die Dunkelziffer am höchsten (da ist die Mutter Else im „Fest“ wohl nicht untypisch). Dramaturg Katzschmann zitiert im Programmheft Studien, wonach vermutlich „in jeder Schulklasse mindestens ein bis zwei Kinder Missbrauch erleiden oder erlitten haben“.
Happy End also? Bis dahin ist wohl noch ein weiter Weg.
Landestheater Detmold:
Das Fest
Schauspiel nach dem gleichnamigen Film von Thomas Vinterberg und Mogens Rukov
Übersetzung: Renate Bleibtreu
Bühnenfassung: Juliane Gruner und Burhard C. Kosminski
Inszenierung: Martin Pfaff
Ausstattung: Petra Mollérus
Dramaturgie: Christian Katzschmann
Helge: Gustav Peter Wöhler
Else: Kerstin Klinder
Christian: Markus Hottgenroth
Helene: Marie Luisa Kerkhoff
Michael: Hubertus Brandt
Mette: Nicola Schubert
Said: Adrian Thomser
Großvater: Henry Klinder
Helmut v. Sachs: Jürgen Roth
Kim: Holger Teßmann
Michelle: Jorida Sorra
Pia: Kathrin Berg
Lars: Lukas Schrenk