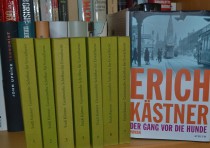"gute aussichten"? - Wenige Perlen zwischen viel Trivialem
Junge Fotograf-inn-en stellen im Herforder MARTa aus
Urlaubsbilder und ...
WaSa - Haben Sie schon mal Urlaub auf Dom-Rep gemacht? Wenn Sie eine Seite wie diese hier lesen, dann begnügen Sie sich vermutlich nicht mit dem All-inclusiv-Aufenthalt im luxuriösen Ferienresort, sondern lernen auch Land und Leute kennen; Sie wissen, dass dieser Staat eigentlich Dominikanische Republik heißt und Teil einer Insel ist, deren anderen Teil Haiti einnimmt, eines der elendesten Länder unserer Welt. Und bestimmt haben Sie Fotos gemacht:
Fotos vom Regenwald. Fotos von spielenden Kindern. Vom Vogel auf dem Frühstückstisch. Vielleicht haben Sie sich getraut, Menschen zu fotografieren: einen Mann mit Zigarettenstummel im knittrigen Gesicht; einen stolzen Schwarzen mit nacktem Oberkörper, der sich seiner Kraft und Schönheit bewusst ist; eine attraktive Frau, der wir wohl Unrecht tun, wenn wir sie für eine Prostituierte halten, bloß weil sie mit ihren schönen Oberschenkeln auf einer roten Bettdecke kniet und herausfordernd in die Kamera blickt. Wenn Sie genug Mut hatten, haben Sie auch bewaffnete Soldaten fotografiert. Und mit viel Glück haben Sie ein Motiv gefunden, das Heinrich Bölls berühmte „Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral“ illustriert: den Einheimischen, der neben seinem Fischerboot im Sand schläft, während im Hintergrund ein Tourist aus dem Meer kommt ...
... Familienfotos ...
Vielleicht haben Sie auch eine Tante, zumindest eine gute Bekannte mit dem – fiktiven? – Namen Bea. Noch nicht sehr alt, nicht mehr ganz jung. Und die fotografieren Sie. Mal draußen unter Bäumen, mal drinnen auf dem Sofa. Mal im Schlabberpulli, mal im Glitzerkleid; mal mit Schal, mal in Unterwäsche. Mal lächelnd, meist aber mit einem Blick, den man als melancholisch bis traurig interpretieren könnte. Dazuhin fotografieren Sie auch noch Beas löchrige Bettdecke oder ihre Hose auf dem Bügelbrett.
In beiden Fällen – bei Tante Bea wie bei Dom Rep – stellt sich die Frage: Was tun mit den Fotos? Sie und ich, wir würden einen Teil als irrelevant und nichtssagend einfach löschen. Die gelungenen Urlaubsbilder stolz herumzeigen. Die Tantenfotos im – digitalen oder papiernen – Familienalbum archivieren.
... oder doch Museumskunst?
Wenn man aber Fotograf ist, oder Künstler, oder wenigstens einschlägiger Student .... und wenn man dann noch auf eine Jury trifft, die das verwischte Urwaldfoto nicht für unscharf hält, sondern für Kunst; die im vom Bildrand abgeschnittenen Kopf der Tante kein Malheur sieht, sondern Ausdruck für Beas Befindlichkeit ... dann, ja dann landen die Fotos nicht im elektronischen Nirwana oder in der Unendlichkeit einer Cloud, sondern an einer Museumswand, zum Beispiel im renommierten, gerade erst zum „Museum des Jahres“ geadelten Herforder MARTa.
Ausstellung „gute aussichten – junge deutsche fotografie 2014/15“
An einem Novembersonntag wurde hier die Ausstellung „gute aussichten – junge deutsche fotografie 2014/15“ eröffnet. Das Projekt „gute aussichten“ wurde 2004 von der Kunstwissenschaftlerin Josefine Raab und dem Journalisten Stefan Becht begründet und bietet jetzt zum 11. Male jungen Fotograf-inn-en Gelegenheit, ihre Werke einem breiten Publikum vorzustellen. Schon zum dritten Male fand der Auftakt im Marta statt. Hier sind die Fotos noch bis zum 11. Januar 2015 zu sehen; danach gehen sie ins Hamburger Haus der Fotografie in den Deichtorhallen (22.01. – 08.03.2015) und von dort in die Goethe-Institute Washington, Nicosia, Tallinn und Mexico City sowie ins Landesmuseum Koblenz.
Die Preisträger (1-8) und die Ausstellungs-Macher (A+B)
Die siebenköpfige Jury hatte durchaus die Wahl: „von 115 eingereichten Portfolios aus 40 Institutionen (wählte sie) acht Preisträger aus“ – man darf also schon erwarten, hier auf eine Elite der jungen deutschen Fotografie zu treffen.
„Quisqueya – wunderbares doch geteiltes Land“
Und dann diese Dom-Rep-Urlaubsbilder von Jannis Schulze (* 1987 in Berlin, Master of Arts Visuelle Kommunikation, Weißensee Kunsthochschule Berlin)! Natürlich werden diese Fotos geadelt: dadurch, dass der Vater des Fotografen aus der Dominikanischen Republik stammt, dass der deshalb weiß, dass die Einheimischen ihre Insel Quisqueya nennen (so deshalb auch der Titel), dass er durch einen längeren Aufenthalt im Haus der Großmutter besseren Kontakt zu den Leuten bekam als ein normaler Tourist.
„Die Themen Migration und Heimat waren dadurch präsent. Darüber hinaus hat mich das Motiv der Insel als Paradies interessiert“. - Sag ich doch: Urlaubsbilder! Oder von mir aus auch – wie’s der Katalog ausdrückt -: „anthropologischer Reisebericht“ (auch wenn für den wissenschaftlichen Anspruch, der in dieser Formulierung mitschwingt, das Systematische fehlt).
„Spuren – die vielen Gesichter einer Verlorenen“
Ja, und dann diese Tante-Bea-Bilder von Kolja Warnecke (* 1988 in Hamburg, BA Kommunikationsdesign, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg). Natürlich erhalten auch diese biederen Fotos eine zusätzliche Dimension, werden gar mit einer Portion Verruchtheit aufgeladen; denn Bea ist eben nicht Koljas Tante; vielmehr hat er sie bei einem früheren Projekt „Nightlife“ in einem Swinger-Club kennengelernt ... und so mag denn der Betrachter in Phantasien schwelgen, was das wohl für „Spuren“ im „Gesicht einer Verlorenen“ sein mögen ... Vorausgesetzt, der Betrachter kennt diesen Hintergrund.
Mehr Information, bitte!
Vieles von dem, was nach Meinung der Jury aus diesen Fotos Museumskunst macht, erfährt man nur, wenn man den Katalog kauft (was man natürlich immer tun muss, wenn man sich mit einer Ausstellung gründlicher befassen will). Etwas mehr Information im unmittelbaren Umfeld der gehängten Fotos würde man sich da schon wünschen!
Kluge Worte und greuliche Verse zur Eröffnung
Natürlich erfährt man auch einiges von Josefine Raab, der Begründerin und guten Seele dieses „gute aussichten“-Projekts. Zur Ausstellungseröffnung stellt sie die Künstler vor, mit einigen klugen Bemerkungen zu ihren Objekten. Doch dem ist im Gewühl von vielen Dutzend Eröffnungsgästen nicht immer ganz leicht zu folgen.
Und dann appelliert Josefine Raab mehrfach an die Besucher, doch die einmalige Gelegenheit zu nutzen, mit den – allesamt anwesenden – Fotograf-inn-en „ins Gespräch zu kommen“. Schade, Frau Raab, dass Sie denen nicht die Gelegenheit gegeben haben, selbst ein paar einführende Worte zu ihren Werken zu sprechen.
Leider darf stattdessen eine als „kleines Sprachgenie“ angekündigte junge Frau namens Mara zu jeder Bildergruppe ein selbstverfasstes Gedicht vorlesen; beim Hören in der Eröffnungshektik scheinen diese Texte arg bemüht-manieriert; beim Nachlesen wirken sie in ihrer Reim-dich-oder-ich-fress-dich-Holprigkeit nur noch peinlich.
Der Katalog bescheinigt den Fotograf-inn-en, sich „mit den grundlegenden, den existenziellen Fragen unseres Lebens“ zu beschäftigen. „Back to the roots“ nannte das der künstlerische Direktor des Marta, Roland Nachtigäller, in seiner Begrüßungsrede. „Die acht Preisträger sind dem Leben dicht auf der Spur. Die Themen Tod, Migration, gesellschaftliche Diskriminierung, Einsamkeit, Verzweiflung stehen Freude, Erkenntnis, Vielfalt und schöpferischer Kraft gegenüber“. – Was könnte man mehr wollen? Da kann sich doch jeder wiederfinden. Irgendwie.
„Ein Tag im Oktober. Oder November. Oder Dezember“
Selbst Alexander Mitscherlich könnte sich womöglich wiederfinden: in dem „Panorama der Nebensächlichkeiten“ der Katharina Fricke (* 1982 in Rostock, Bachelor of Arts in Fotografie und Medien, FH Bielefeld). Wirken die 150 kleinformatigen herbstlichen Schwarz-Weiß-Fotos aus der Bielefelder Schlafstadt Sennestadt doch wie Illustrationen zu Mitscherlichs „Pamphlet“ wider „die Unwirtlichkeit unserer Städte“, mit dem er 1965 – das ist jetzt auch schon 50 Jahre her! – eine heftige und anhaltende Debatte über das Elend des (damals) zeitgenössischen Städtebaus auslöste.
Hierfür scheint Sennestadt ein perfektes Beispiel: ein Ort, „wo man schläft, aber nicht wohnt“ (Raab). Ausgespart wird dabei, dass Sennestadt mal als Modellprojekt nach Prinzipien einer „organischen Stadtbaukunst“ entstand und in jüngerer Zeit durchaus ernsthafte Bemühungen einer städtebaulichen Aufwertung erfuhr. – Aber mal unterstellt, all diese Fotos von menschenleeren Plätzen, öden Klinkerwänden und trostlosen Garagenzufahrten seien tatsächlich repräsentativ für diese Siedlung, so wären sie vielleicht ideal als Anschauungsmaterial für eine Debatte im Bielefelder Ausschuss für Stadtentwicklung. Aber ob sie ins Museum gehören?
„Was ist eine Sekunde, wenn neben ihr die Welt steht?“
Aber ob das ins Museum gehört? frage ich mich auch bei der Videoinstallation von Karolin Back (* 1980 in Stuttgart, Diplom Visuelle Kommunikation (Kunst und Medien) Hochschule für Gestaltung Offenbach). Sie hat das Matterhorn („den Berg der Berge“) gefilmt; und im Katalog ist in hochgestochenen Worten viel die Rede von „Farbe, Licht und Projektion“ und ihrem Aufeinanderwirken. Was man sieht, ist das Bild des Berges, sowie bei genauerem Hinblicken von sich bewegenden kleinen Gestalten (Bergwanderern, vermutlich). Und dann wird noch geschwurbelt über die „Rolle des Betrachters, der unverhofft in die Gestaltung des Bildes eingreift“ – Ach du meine Güte!!! - Gemeint ist der Schatten, der entsteht, wenn ein Besucher zwischen Lichtquelle und Leinwand tritt.
Und natürlich kann man – angeregt vom Titel und angesichts der gleichbleibenden Bergform und der sich ändernden Details – lange philosophieren (oder besser: meditieren) über Beständigkeit und Wandel, über Ewigkeit und Vergänglichkeit ... Oh mein Gott!
Dass Josefine Raab bei ihrer Einführung die Reihenfolge der Wörter im Titel verwechselte ("Was ist die Welt, wenn neben ihr eine Sekunde steht"), und dann auch noch meinte "es ist beides möglich", zeigt doch die Beliebigkeit! (Vielleicht sollte ich meine zahlreichen Fotos der Eiger-Nordwand mal in einer Endlosschleife hintereinanderhängen; ein (denk-)anstößiger Spruch dazu fällt mir dann auch noch ein.)
„Ein Bild abgeben“
Stefanie Schroeder (* 1981 in Weimar, Professional Media Master Class, Werkleitz Gesellschaft Halle) dokumentierte „acht Jahre lang Jobs, die sie annahm, um ihr Studium zu finanzieren“. Das Ergebnis zeigt sie als 18-minütige „Projektion mit Sound“. Ein Kommentar ist mir nicht möglich, denn nachdem lange Sekunden nur schwarzes Nichts auf der Leinwand zu sehen war und anschließend eine stroboskopartige Abfolge von Bildern, von denen wegen der blitzartigen Aufeinanderfolge auch nichts zu erkennen war, bin ich gegangen. Ja, ich weiß – man darf nicht so ungeduldig sein. Aber schließlich haben noch sieben andere Ausstellungsabteilungen gewartet.
Und immerhin drei davon waren durchaus sehenswert:
„Moderne Tradition“
Heißt das nun „moderne Tradition“ oder „Moderne. Tradition.“, was über diesen Bildern steht? Passen würde beides. Eduard Zent (* 1983 in Orsk, Russland, Bachelor of Arts in Fotografie und Medien, FH Bielefeld) hat einfach Menschen fotografiert: Menschen verschiedenster Herkünfte (russisch-mongolisch, ceylonesisch, afrikanisch ....) in „traditionellen Kleidungsstücken und Accessoires“ (oder – vielleicht – was wir dafür zu halten bereit sind). Auch wenn die Forderung altmodisch und verpönt ist, wer Kunst mache, müsse zunächst einmal das zugrundeliegende Handwerk beherrschen – bei Zent beeindruckt zunächst einmal die ruhige Professionalität, mit der er seine Modelle ins Bild setzt, mit der er seine Fotos inszeniert. Vor dem schwarzen, besser: leeren Hintergrund konzentriert sich der Blick ganz auf die porträtierten Menschen, die Gelassenheit, Schönheit, Würde ausstrahlen und so ähnlich auch von den niederländischen Meistern gemalt sein könnten.
Was diesen Bildern jenen gewissen Kick verschafft, der aus ihnen mehr macht als handwerklich gelungene und ansprechende Portraits, das sind – meist unauffällige – Details, die die Aufmerksamkeit, den zweiten Blick des Betrachters (er-)fordern, dann aber auch zum Denken anregen, zumindest zu einem „Aha“-Effekt führen: Da ist die exotisch gewandete junge Schönheit mit ihrem Korb von Kartoffeln – als ob sie (wo nicht vom eigenen Feld) gerade vom Dorfmarkt käme – doch der genauere Blick zeigt, dass die Kartoffeln aus dem Supermarkt stammen. Der junge Mann in der ehrwürdigen Vätertracht, wo (auch wegen der farblichen Konkordanz) ebenfalls ein zweiter Blick nötig ist, um die Motorradhandschuhe und den –helm zu identifizieren. Ähnlich der Ghanaer, dessen Sportschuhe die Farben seines exotischen Gewandes nur ein bisschen greller widerspiegeln ...
Kurz: beeindruckende Fotos „einer Welt, in der sich entfernte Kulturen ebenso miteinander verflechten wie Traditionelles mit Modernem“.
„Erbgericht“
Ein rätselhafter Titel; der Katalog erklärt eingehend den historischen Hintergrund und die Namensherkunft des Gebäudes, in dem Andrea Grützner fotografiert hat (* 1984 in Pirna, Master of Arts in Gestaltung, Schwerpunkt Fotografie, FH Bielefeld). Für das Verständnis genügt es zu wissen, dass es sich um einen Gasthof im sächsischen Polenz handelt (so viel allerdings hätte man ruhig dazu schreiben können!).
Die Bilder muten teilweise geradezu surrealistisch an – und doch sind es samt und sonders naturalistische Fotos aus einem alten Dorfwirtshaus, deren Ausstrahlung zwar auch durch den Einsatz farbiger Blitze akzentuiert wird, deren starke Wirkung aber vor allem der genialen Wahl der Bildausschnitte durch die Fotografin zu verdanken ist, aus der sich ein faszinierendes Zusammenspiel von Farben und Formen, insbesondere auch eine erstaunliche Kombination von Schatten und Licht entwickelt. Auch hier bedarf es oft des zweiten Blickes, um zu erkennen, was man sieht: Der zweigeteilte Kreis könnte von Klee gemalt sein, ist aber das Foto vom Schatten einer Lampe; was wie ein Bild von Kandinsky daherkommt, erweist sich als ordinäre Vorhangschiene ... Insgesamt: Reizvolle Grafiken, hinter denen mehr steckt als abstrakte Formen!
„Es ist nicht so gewesen“
Geradezu ergriffen haben mich die Fotos von Marvin Hüttermann (* 1987 in Oberhausen, Master of Arts, Kommunikationsdesign, FH Düsseldorf). Dabei hatte ich mich zunächst mal – mal wieder – gründlich geärgert über die Zumutung, mir derart triviale, alltäglich-nichtssagende, Bilder ansehen zu sollen. Ein leerer Tisch, Ein ungenutzer Holzbock. Eine (angeschnittene) vergessene Lampe. Für den Flohmarkt zurechtgelegte Bücher ... Wie banal! Aber allmählich entwickelt sich die Erkenntnis: Hier ist eine Geschichte dargestellt. Die Geschichte, die abgeschlossene Geschichte eines (oder auch: mehrerer) Menschen. Was wir sehen sind Reste. Die Überbleibsel einer Existenz. Und so ist es dann immer noch nicht gewesen.
Allmählich, vereinzelt zunächst, sind Bilder dazwischen von Räumen, die so ähnlich aussehen wie die Pathologie im „Tatort“. Bilder von Körperteilen. Totes Menschenfleisch. Der unter einer Bettdecke hervorlugende Fuß – an dem ein Namensschild hängt. Oder ist es nur eine Nummer? Und das alles wirkt gar nicht voyeuristisch. Eher als Versuch, einem unspektakulären, zu Ende gegangenen Leben nachzuspüren, ihm ein bisschen Würde zu bewahren. Oder zu verleihen. Am Ende steht dann der Sarg: hell in einem düsteren Umfeld, fast wie ein besonderes, durch Spotlight hervorgehobenes Ausstellungsstück. Und ganz am Schluss, nach all den immer schwarz-weißer, immer grauer werdenden Fotos einer vergehenden Existenz: in lebendig-feurigem Rot die Bilder aus dem Krematorium!
Wenn wir Josefine Raab glauben (und warum sollten wir nicht?), dann sind diese Fotos nicht gestellt, nicht inszeniert. Vielmehr hat Marvin Hüttermann sie als Angestellter eines Bestattungsunternehmens (ist es makaber zu sagen: „live“) gemacht. Beim Aufräumen der Nachlässe. Beim Versorgen der Leichname. Beim Finale im Krematorium.
Kein Kommentar. Die Serie spricht für sich!