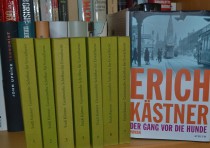Ein gar schröckliches Ritterspektakel – Warum nur?
Städtische Bühnen Münster zeigen (2003):
Das Käthchen von Heilbronn oder die Feuerprobe –
Ein großes historisches Ritterschauspiel von Heinrich von Kleist
Was für ein seltsamer Kauz, dieser Bernd Heinrich Wilhelm von Kleist?
(Münster. WaSa) Dem Spross eines preußisch-adligen Offiziersgeschlechts war die militärische Karriere vorgezeichnet, die er denn auch mit 15 im Garderegiment hoffnungsvoll begann. Aber schon mit 22 zog er seine Leutnantsuniform aus und schrieb später nicht gerade standesgemäße Geschichten über einen sprichwörtlich gewordenen Aufrührer wider die Obrigkeit oder über eine Marquise, die per Zeitungsanzeige nachforscht, wer sie wohl geschwängert habe. Außerdem Stücke, in denen wildgewordene Amazonen, korrupte Richter oder sich zerfleischende Grafenfamilien (deren Kinder Romeo und Julia spielen) auftreten. Ach! Das letztgenannte hat Kleist selbst als „elende Scharteke“ diffamiert – so hätte er gerne auch sein albernstes Stück nennen dürfen: „Das Käthchen von Heilbronn oder die Feuerprobe – Ein großes historisches Ritterschauspiel“.
„Käthchen von Heilbronn“ - was ist das für ein albernes Stück?
Schon der marktschreierische Titel erweckt den Eindruck, da habe der Karl May der „Waldröschen“-Zeit mit Hedwig Courths-Mahler die Gene gemixt, um den ultimativen Trivialautoren hervorzubringen. Ein Eindruck, den die Lektüre dieses Ritterspektakels keineswegs widerlegt: In einer düsteren Höhle verhandelt das geheime Femegerichte die Klage eines biederen Waffenschmiedes wider den Verführer seines Töchterchens. In einer wüsten Gewitternacht rettet ein edler Graf ein geraubtes Burgfräulein aus einer elenden Köhlerhütte. Finstere Raubritter brandschatzen fremde Burgen. Eine reine Liebe, die an Standesunterschieden zu scheitern droht, wird durch das finale Eingreifen eines leibhaftigen Kaisers (eines imperator ex machina, sozusagen, der sich als früher Lüstling outet) zum Happy End geführt ...
Auch handwerklich ist das „Käthchen“ nicht gerade ein Beispiel mustergültiger klassisch-deutscher Dramatik: Schlampereien im zeitlichen Ablauf der Handlung sind da noch das Geringste. Aber: Immer wieder aufs Neue werden Handlungsstränge begonnen, die dann nicht weitergeführt werden. Jede Menge Personal taucht ganz nach Bedarf auf: Grafen, Ritter, Burgherren, ein Nachtwächter, eine Stiefmutter, Einsiedler, Köhler und zum Schluss auch noch vier Mohren. - Haben die alle dann ihre Schuldigkeit getan, brauchen sie noch nicht einmal zu gehen, sie werden einfach wieder vergessen. Als beispielsweise die entführte Kunigunde von ihrem Retter auf dessen Burg gebracht wird, ist – wie praktisch! – ihre Kammerzofe schon da. Die (in einer frühen Fassung enthaltene) Lösung dieses Rätsels (= die Zofe wurde von einem „zarten Mondscheins-Regenbogen“ an ihren Bestimmungsort geleitet) hat selbst Kleist als zu unwahrscheinlich-romantizistisch verworfen.
Kein Wunder, dass dieses Stück von Anfang an umstritten war. Und heute? Da Standesgrenzen kein Hindernis mehr für romantische Liebe (so es die noch gibt) bilden? Wo man nicht mehr an Cherubim glaubt, die unschuldige Mädchen aus dem Feuer retten (dazu hatte schon 1779 – Kleist war damals 2 Jahre alt - Lessing seinen Nathan das Nötige sagen lassen), geschweige denn Ehen stiften? Wer diese gar schröckliche Rittersleut-Schmonzette heute aufführen will, der sollte eine gute Inszenierungs-Idee haben. Einfach runterspielen, in der Hoffnung, das würde schon als „werkgetreu“ durchgehen, das geht nun wirklich nicht mehr!
Was sagt uns diese Inszenierung?
Es fällt schwer, diese Idee hinter Schmalöers Inszenierung zu entdecken. Suchen wir sie also im Programmheft: Neben pauschalen Verweisen auf Parodistisches und vor allem „Märchenhaftes“ werden Unsicherheit und Verwirrung zu zentralen Erklärungsansätzen. Im Bühnenbild findet man dies leicht wieder: einer kahle Fläche unter sich kreuzenden Stegen, über die die Akteure wie über Abgründen trippeln; eine entwurzelte Eiche bestimmt vage die Standorte; einzige ungewisse Zuflucht könnte eine löchrige Hütte bieten, die zu Anfang aus dem Schnürboden herabschwebt, jedoch bald wieder verloren ist ... Sollen auch die Kostüme eine stilistische Unbehaustheit suggerieren? Die zeigen nämlich ein wirres Durcheinander: die Bürger tragen Bratenrock, Gräfin und Kammerzofe schicke Kostüme, der Kaiser (der in Habitus und Duktus einem Dorfschullehrer gleicht) einen Kaufhausanzug zur Pappkrone. Die Ritter legen immer dann, wenn’s ans Ritterhandwerk geht, alberne Röcke an, die Femerichter tragen von Anfang an unsägliche Reifrock-Abendkleider ...
Was in diesem Ambiente geschieht, wird also im Programmheft so erklärt: „Nichts in dieser traumhaften Welt ist so, wie es scheint. Die alte Ordnung ist zerfallen und eine neue noch nicht gefunden. Bestimmend für alle Figuren sind ihre Gedanken- und Gefühlsverwirrungen; nur die Titelfigur scheint Gewissheit zu haben, sie glaubt an die Wahrheit des Gefühls“ – das wiederum seinen Ursprung in Aberglauben (Bleigießen) und Traumbildern hat. Reicht das wirklich? Ist dieses Postulat einer Allgemeinen Verunsicherung nicht doch ein bisschen banal? Und erst die märchenhafte Moral aus dieser Geschichte: Glaube nur unbeirrt an deine Träume, dann wird ein edler Graf unter tätiger Mithilfe eines himmlischen Cherub und eines lieben Kaisers schon alles zum Guten richten. Kann das wirklich die Botschaft sein?
Inszenierung: Volker Schmalöer
Bühne: Pia Janssen
Kostüme: Ulrike Obermüller
Dramaturgie: Horst Busch