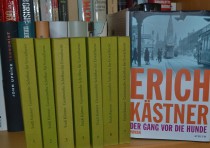Vier Versuche, sich einem schwierigen Erfolgsstück anzunähern
Jon Fosses „Winter“ in Bielefeld und Bochum (Juni 2002)
1. Versuch: Rede an das Stück in dessen eigener Sprache
WaSa. - Du – Du – Du da – Du – Ja Du – Ich lese Dich – Ja Dich – Ja – Ich sehe Dich – Ja Dich – Ich sehe Dich nochmal – Ja – Verstehe ich Dich – Ja - Ja natürlich – Nein - Ja – Ich verstehe – Jetzt schreibe ich über Dich – Oder – Ich weiß nicht – Ja – Ja – Ich versuche es – Ja – Ich bin dein Kritiker – ich – weißt du – nicht wahr – nicht wahr ich bin dein Kritiker – Oder - ich bin nicht dein Kritiker – Ich verstehe dich ja gar nicht – Doch – Doch ich verstehe dich – nicht wahr – Aber – Ja – Ich hab gedacht ... – Ich weiß nicht – Ja – Ja – Ja – Ja – Ja - Oder – Nein – So ist das nicht – Alles ist so
Kann der Versuch gelingen, dieses Stück in seiner eigenen Sprache zu besprechen? Also über das Stück, sein Personal, seine Probleme so zu kommunizieren, wie seine Personen sprechen? Ich glaube nicht. Auch das „Publikumsgespräch“, an dem ich nach der 5. Aufführung in Bochum teilnahm, spielte sich in unserer (das heißt: der Studienräte, Studenten, höheren Hausfrauen und wer sonst eben solche Gespräche frequentiert) elaborierten Alltagssprache ab. Dörte Lyssewski, die „Frau“, behauptete zwar, sie würde zu Hause in ähnlicher Weise ankündigen, dass sie jetzt einkaufen gehe, aber gegenüber uns schaffte auch sie es nicht (trotz ausgiebigen Trainings), diese Sprache zu verwenden, die Sprache Fosses: lauter Banalitäten, Sprachschablonen; kurze, meist unvollständige Sätze, aber x-mal wiederholt; die ewigen „Ja“s, die dauernden Pausen ... So kann man einfach nicht sprechen, sich nicht austauschen über Theater, Kunst, Politik, soziale Skandale, Urlaubserlebnisse, das Wetter, den jungen Hund der Nachbarn, Familienfreuden, Beziehungsprobleme ....
Beziehungen sind es, die Fosse schildern will, da sie unser Leben steuern. Aber kann man in dieser Sprache eine Beziehung aufbauen und am Leben erhalten, wie es in Fosses Stücken anscheinend immer geschieht und wie seine Fans nicht müde werden zu betonen? Ich bezweifle es. Entweder sind bei Fosse die Beziehungen schon da (und man wundert sich, warum sie nicht im Lauf des Stücks zerbrechen), oder sie entstehen von selbst, aus dem Nichts, im sprachfreien Raum (sie „ereignen sich“, meint der Bielefelder Dramaturg). Sie werden uns vom Autor, vom Regisseur, von den Darstellern präsentiert, lassen sich aber nicht aus dem Text herleiten, nicht auf das zurückführen, was da (nicht) gesagt wird. So wird alles zufällig, beliebig: Medea erwürgt ihre Kinder, ohne von Jason gedemütigt worden zu sein, Faust braucht nicht erst an der menschlichen Beschränktheit verzweifeln, um sich dem Teufel zu verschreiben, Tiger Brown ist Macky Messers Freund, auch ohne mit ihm den Kanonen-Song gesungen zu haben ... Alles zufällig, alles beliebig. Alles sinnlos. Ja. Ja ... Oder ....
2. Versuch: Skandinavier unter sich: Fosse & Andersen
Fosse KANN gute, bühnenwirksame Texte schreiben. Das beweist die herrliche Phantasie über ungeborene Kinder in „Der Name“. Aber warum sollte er gute Texte schreiben für ein Theater, das er nach eigenem Bekunden hasst? Ausgerechnet die genannte Passage im „Namen“, die dem Kritiker einst als Oase in der Kommunikations-Wüste erschien, bezeichnet Fosse im Bochumer Programmheft zwar (zu Recht) als „sehr virtuos“, aber auch als Betriebsunfall, den er nie mehr wiederholen möchte. Er kokettiert richtiggehend mit seiner „schlechten Sprache“, deren systematischer Gebrauch „schwer zu verstehen ist, für manche Menschen besonders“. Recht so! Schließlich verachtet er ein Publikum, das nur ins Theater geht, um „sich selbst als bessere Menschen auszustellen“. Genügt es nicht, denen einen Nicht-Text hinzurotzen? Und sich womöglich darüber zu amüsieren, wie toll die den alle finden? So toll, wie die bornierten Höflinge in Andersens Märchen die Kleider des nackten Kaisers fanden? Jene „manche Menschen“, die seinen Gebrauch schlechter Sprache „besonders schwer“ verstehen - sind das womöglich diejenigen, die ihn in Wirklichkeit am besten verstehen, die sich trauen zu rufen „Der Kaiser ist ja nackt!“ – „Fosse schreibt ja Blödsinn! Seine Figuren reden nur Unsinn!“? Denn im Unterschied zu Andersens Kaiser glaubt Fosse selbst (vermute ich stark) nicht an imaginäre Kleider.
3. Versuch: Das Elend der Kommunikation: Winter in Bielefeld
Natürlich reden die Leute nicht Unsinn – sie können es einfach nicht besser. Schließlich schreibt Fosse nicht über Medea und Faust, noch nicht mal über Macky Messer, sondern allenfalls über den „Mann“, die „Frau“. Die haben keinen Namen. Haben sie damit auch keine soziale Stellung? Keinen Intellekt? Kein Kommunikationsvermögen? Sophie Engert und Klaus Lange in Bielefeld erwecken diesen Eindruck – und folgen damit ziemlich genau den Vorgaben Fosses, der in seinen Stücken die kommunikationsfreie Sprache feiert und damit eine offensichtlich modische Theatermanie zum Exzess treibt. Dieses – von heutigen Dramatikern offensichtlich heiß geliebte – „Elend der Kommunikation“ auf der Bühne darzustellen (eher: zu zelebrieren als anzuprangern!) mag ja gelegentlich verdienstvoll sein, aber in der gegenwärtigen Häufung (vgl. Harrower, Loher, Finkelde, v. Düffel u.v.a.m.) führt das zum Überdruss – soll Theater als per se kommunikiative Anstalt wirklich zur Kommunikationswüste werden? Als ob es in unserer komplizierten Welt keine anderen Probleme gäbe, die einer Verarbeitung durch das Theater bedürften! Kein Zweifel, dass wir heutzutage ein Kommunikationsproblem haben; aber Kommunikationsdefizite in derart krankhafter Ausprägung sind doch eher einer Randgruppe zuzuordnen. Aber: was ist mit den Personen, die die Probleme unserer Welt verursachen? Die sind ganz schön eloquent!
4. Versuch: Winter in Bochum: endlich zum Leben erweckt!
Fosses Verachtung für alle, die Theater nur als Bühne für ihre eigene Selbstdarstellung nutzen wollen, mag verständlich sein. Bedauerlich ist seine Ignoranz all der Enthusiasten, für die Theater eine Leidenschaft ist. Für die letzteren hat Hartmann in Bochum den Winter inszeniert, nicht als Analyse einer unerklärlichen Beziehung, sondern als paralleles, oder eher: gegenläufiges Spiel zweier Protagonisten. In der ersten Hälfte treibt die Frau, ist der Mann der Getriebene. Im zweiten Teil ist die Frau eher zurückhaltend, der Mann der Fordernde. Dabei hat er da schon verloren. Anfangs war er ein guter (Klein-) Bürger: gut gekleidet, in guter Position, (vermutlich gut) verheiratet, mit zwei (vermutlich gut geratenen) Kindern. Und der lässt sich auf etwas ein, das ihn abstürzen lässt. Keiner weiß warum (so ist das bei Fosse), sein Unglück (?) kommt als blinder Schicksalsschlag (so war das schon in der griechischen Tragödie). Ihm gegenüber die Frau, die Halt sucht, wo auch immer. Dörte Lyssewski bietet ein wunderbares Bild einer zerstörten Persönlichkeit: Alkoholikerin? Pennerin? Psychisch Kranke? Im zweiten Teil präsentiert sie sich stolz als Edel-Nutte im schick-obszönen Fummel. Eine Verwandlung wie von der Raupe zum Schmetterling, ohne Zwischenstadium, ohne Entwicklung – die gibt’s nicht bei Fosse. Möglich ist aber Vielschichtigkeit in der Persönlichkeit, und solche zeigen Ernst Stötzner und vor allem Dörte Lyssewski: Womöglich ist sie ja nicht nur cooles Callgirl, sondern auch gefühlvolle Frau, die auf die Liebe reagiert, die der Mann ihr plötzlich entgegen bringt.
So zeigt Hartmann eben nicht die Beziehung, die Fosse will (aber nicht be-schreibt). Dafür spielen Dörte Lyssewski und Ernst Stötzner die Charaktere, die Fosse nicht will. Und retten damit ... nicht das Stück, aber wenigstens die Aufführung.