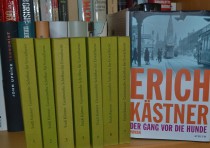Salzburger Festspiele, Felsenreitschule:
Was für ein seltsames Schauspiel … Doch welch ein Hörspiel!
Konwitschny inszeniert (nicht) Artauds/Rihms „Eroberung von Mexico“
NEUTRAL
WEIBLICH
MÄNNLICH
Ich möchte ein furchtbares Weibliches versuchen.
Den Schrei der Revolte, die man mit Füßen tritt …
… der Krieg, den ich führen will,
rührt von dem Krieg her, der gegen mich geführt wird.
Und in meinem Neutralen findet ein Massaker statt! …
Neutral. Weiblich. Männlich. …
Das Weibliche ist dröhnend und furchtbar
wie das Gebelle eines sagenhaften Fleischerhundes …
… mein Schrei ist ein Traum.
Aber ein Traum, der den Traum auffrisst …
(Antonin Artaud: Das Seraphim-Theater
Mexiko 1936)
Die Klänge:
g.WaSa - Salzburg. - Rhythmen Summmmen „Aaaaaaa-!“ Bassgebrummmm „Ooooo-!“ Hoher, „sehr hoher Sopran“ „Ä-! (A long sound somewhere between the e in bed and the diphthong in air)“ Zwei solitäre Violinen, virtuos „Hörbare Atemstöße“ „Ch-!“ „A-! O-!“ „Wind“ „A-! O-! N-!“ …
Man taucht ein, versinkt, wird überflutet von einer Klangwelt, von Klangwelten, die sich nicht nur von vorne speisen, aus dem Orchestergraben, der hier, in der Salzburger Felsenreitschule, kein Graben ist, wo vielmehr das Wiener ORF-Radio-Symphonieorchester mit dem Zuhörer, der Zuschauerin auf Augenhöhe musiziert … , Klangwelten, die einen umgeben, einhüllen, von allen Seiten … Schlagzeuger hinter dem, mitten im Publikum … ein Chor (ein Chor?) auf den hinteren Rängen (später wird er die Bühne stürmen) … dazu Chorgesang aus Lautsprechern, vom Band …
Alles in allem, so man sich darauf einlassen will: ein aufmerksamkeit-heischendes, verwirrendes, hypnotisch-besitzergreifendes, rätselhaftes … kurz: faszinierendes Klangerlebnis. (Als Sahnehäubchen gibt’s noch das optische Erlebnis, das Ingo Metzmacher bietet, wie er da sein komplexes Orchester dirigiert.)
Dass die Salzburger „Festspiele 2015 mit zeitgenössischer Musik eröffnet werden, sollte ein klares Statement“ sein, erklärt die langjährige Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler. Eigentlich sollte ja pro Saison eine zeitgenössische Oper uraufgeführt werden – in diesem Jahr „Endspiel“, ein von György Kurtág vertonter Beckett-Text; doch da sich der fast 90jährige Komponist nicht drängeln ließ, musste man, konnte man auf Wolfgang Rihms „Die Eroberung von Mexico“ zurückgreifen: ein Werk, das zwar schon 1992 (in Hamburg) uraufgeführt wurde, seither aber so gut wie nie zu sehen war, da sich ein „normales“ Stadttheater kaum an das Stück heranwagen dürfte – allein schon wegen der (quantitativen) musikalischen Anforderungen, womöglich auch wegen des dadahaft-surrealistischen Sujets.
Die Seltsamkeit dieser Oper, ihrer Salzburger Inszenierung zumal, erschließt sich womöglich erst dann ganz, wenn man die einzelnen Schichten aufdröselt – auch das eigentlich ein aussichtsloses Unterfangen. Der Versuch, immerhin, sei gewagt:
Die literarische Vorlage:
Antonin Artaud (1896-1948) als „Surrealisten“ zu bezeichnen, greift sicherlich viel zu kurz, doch muss hier der Hinweis genügen, dass er Anfang der 1930er Jahre in Paris zahlreiche Positionen der Surrealisten teilte. Damals (also noch vor seiner Mexiko-Reise 1936) verfasste er das Szenarium „La Conquête du Mexique“, „Die Eroberung Mexikos“, das den Prinzipien seines „Theaters der Grausamkeit“ idealtypisch entspricht (BLÜHER *) )
Die französischen Surrealisten wandten sich damals engagiert gegen den Kolonialismus, der (nicht nur) in Frankreich sozusagen noch zur Staatsraison gehörte.
Der – längst widerlegte, aber scheint’s immer noch unausrottbare – Mythos vom „edlen Wilden“, der mit seiner Umwelt und seiner Mitwelt in friedlicher Harmonie lebe, bestimmte natürlich auch die Sicht jener Surrealisten auf die Kolonialvölker. „Die Eroberung Mexikos“ war für Artaud demgemäß der Zusammenprall zweier Kulturen: den Europäern einerseits: den „auf den ungerechtesten, härtesten materiellen Grundsätzen basierenden tyrannisch-archaischen Kolonisatoren“, andererseits den Azteken und ihrer „auf unbestreitbaren geistigen Grundsätzen beruhenden organischen Monarchie“ in ihrer „ganzen moralischen Harmonie“.
Keinesfalls sollen hier die mit der spanischen Eroberung Mittel- und Südamerikas verbundenen Scheußlichkeiten bestritten oder auch nur relativiert werden. Allerdings ignoriert Artaud grandios den repressiven Charakter der strikt hierarchisch gegliederten aztekischen Kasten-Gesellschaft; einer Gesellschaft, die regelmäßig „Blumenkriege“ führte zu dem alleinigen Zweck, Kriegsgefangene als Nachschub für ihre Menschenopfer-Rituale zu gewinnen; den Gefangenen wurde dann zu Ehren des Gottes Huitzilopochtli das Herz aus dem lebendigen Leib gerissen; andere Götter bevorzugten das Pfählen, Verbrennen oder – besonders beliebt – Häuten der ihnen Geweihten. Da der Regengott Tlaloc eine Vorliebe für Kindertränen hatte, brachte man Kinder zum Weinen – mit Methoden, welche Artaud wohl lieber nicht so genau kennen wollte, als er seine naive Bewunderung mit der ebenso grausligen wie abstrusen Rechtfertigung auf die Spitze trieb:
„… ungeachtet der Menschenopfer, die schlimmstenfalls eine Abweichung von einem moralischen Prinzip sind und die, sollten sie zur echten Tradition der aztekischen Kultur gehören, einmal auf ihren moralischen, zutiefst reinigenden Gehalt hin betrachtet werden müssten.“ (Artaud: La Conquête du Mexique, 1933).
Nun gut – Artaud war kein Historiker, kein Wissenschaftler, sondern sah sich als Künstler, während die Behörden ihm – der jahrelang mit Drogen gelebt hatte – Schizophrenie bescheinigten und ihn ins Irrenhaus steckten.
Die Oper:
Wolfgang Rihm (* 1952) hat aus Artauds Szenarium „La Conquête du Mexique“ ein Libretto geformt und dieses vertont. Die epochale Auseinandersetzung zwischen zwei Kontinenten, zwischen zwei Kulturen konzentriert Rihm auf das Mit- und Gegeneinander von zwei Prinzipien: hier der Bariton: das grausam-eindringende Männliche: Cortez; da der Sopran, das nicht minder grausam-verteidigende Weibliche: Montezuma. ER wird begleitet, unterstützt von zwei summenden, brummenden, tönenden Männerstimmen; SIE von einer sehr hohen Sopran- und einer Altstimme.
Diese beiden Pole und die Musik – mehr braucht es nicht, uns zunächst einmal in „eine Landschaft, die das Gewitter kommen spürt“ zu versetzen, uns dann an der Begegnung Europa - Amerika teilhaben zu lassen, an der Faszination, mit der sich Cortez und Montezuma gegenseitig anziehen, an der Großzügigkeit, mit der sie sich austauschen: ihren Respekt, ihre Götterbilder, ihre Geschenke …. Dann: der Umschlag der Großzügigkeit in Gier. Der Sympathie in Hass. Krieg! Mord! Tod!
Als ob Artauds Vorlage auf diese Weise nicht bereits genug Gelegenheiten für traumhafte bis traumatische Assoziationen geboten hätte, vielleicht auch aus Angst, eine gar zu einfache „historische Oper“ verfertigt zu haben, hat Rihm noch einen zweiten surrealistischen Artaud-Text dazwischen gemixt: „Das Seraphim-Theater“ („NEUTRAL WEIBLICH MÄNNLICH“), 1936 in Mexiko entstanden, und das Ganze dann noch ergänzt durch ein düsteres Liebesgedicht von Octavia Paz (1937; s.u.) und das abgrundtraurige Klagelied eines unbekannten – aller Wahrscheinlichkeit nach aztekischen – Verfassers von 1523:
...
Der Krieg würgt die Tlatelolca
Sie haben Cuauhtémoc gefangen …
Cuauhtémoc, Coanacoch, Tetlepanquetzaltzin
Die einst Könige waren, sind nun Gefangene …
Geschlagene Könige legt man in goldene Ketten …
Ein Sklave bist du, gehörst einem andern
Einen Halsschmuck gab man Dir in Coyoacan
Der ist nicht aus Quetzalfedern gewoben …
Mit Eisen binden sie Dich! …
Unsere Klageschreie gellen auf
Unsere Tränen fallen herab
Tlatelolco ist verloren …
Unsere Stadt steht in Flammen …
Weint, meine Freunde, seht ein,
das mexikanische Reich ist verloren
Das Wasser ist bitter geworden
Die Nahrung ist bitter geworden …
Nur Blumen und Trauergesänge bleiben noch
In Mexiko und Tlatelolco
Wo wir einst Krieger und Weise sahen …
Aber auch das derart surrealisierte Libretto ließe sich immer noch bequem als Historie lesen. Und die grandiose Kulisse der Felsenreitschule erlaubt noch die Illusion, sich in einem aztekischen Tempel zu befinden (denn wer hat schon eine Vorstellung, wie das Innere eines aztekischen Tempels wirklich aussehen mag), vor allem wenn dann später die Arkaden in (blut)rotes Licht getaucht sind …
Doch dann kam Peter Konwitschny, „bewusst gewählt“ von der Festspielleitung, da „der sich selbst als Antichrist der Freunde der toten Oper bezeichnet“ (Präsidentin Rabl-Stadler). Und der hat der „Eroberung“ alles Mexikanische (alles Historische ohnehin) ausgetrieben – mal abgesehen von einem mexikanischen Teppich, von einem Bild (von dem noch zu sprechen sein wird) und von einer Flasche Tequila (auf die er extra hinweisen muss, da sie schon aus der dritten Zuschauerreihe nicht mehr erkennbar ist).
Die Bühne:
Mit Konwitschny kam sein Ausstatter Johannes Leiacker, der den Regisseur tatkräftig unterstützt. Wo das Libretto eine „prachtvolle Stadtlandschaft“ vorsieht (und man an die reiche Hauptstadtinsel Tenochtitlan denkt), hat Leiacker einen gigantischen Autofriedhof übereinandergeschichtet – aus überlebensgroß wirkenden vor sich hin rostenden Karrossen. Dass an den Schrottautos noch die Scheinwerfer brennen, verleiht ihnen einen quasi dämonischen Charakter – wie im Szenario zu einem Stephen-King-Roman. Mitten hineingestellt in diese Monsterlandschaft: ein winziger Guckkasten mit einem gut-kleinbürgerlichen Wohnzimmer. Und drinnen waltet die züchtige Hausfrau: Doris Day wischt Staub, wo eigentlich Montezuma über das Kriegervolk der Azteken herrschen sollte.
Die Inszenierung:
1950er-Jahre-kleinbürgerlich bleibt dann auch die Tragikomödie, die sich jetzt entwickelt und erst allmählich Richtung Grand Guignol abdriftet: Das blonde Hausmütterchen (Angela Denoke) räumt die ohnehin blitzblanke Wohnung auf, während sie den ersten Besuch eines Verehrers erwartet, den sie wohl per Kontaktanzeige aquiriert hat; der streicht mit seinem Rosenstrauß schüchtern-unentschlossen ums Haus, bevor er sich hineintraut – und dann sofort zum Manne mutiert, will sagen: zur Bestie (Bo Skovhus).
Denn so naiv, wie Artaud den edlen Wilden gegen den grausamen Europäer setzt, so naiv übernehmen Konwitschny/Leiacker das primitiv-feministische Klischee vom bösen Mann und der lieben Frau. Symptomatisch dafür: Leiackers Interpretation des Gemäldes, das er über das blütenweiße Sofa gehängt hat: „Der verletzte Hirsch“ der mexikanischen Malerin Frida Kahlo. Frida Kahlo wurde als junges Mädchen durch einen Unfall grausam verwundet und litt ihr kurzes Leben lang an den Folgen: Schmerzen, die Unfähigkeit, Kinder zu bekommen, monatelange Krankenhausaufenthalte und immer neue Operationen. Das alles spiegelt sich in ihrem Werk, das zum großen Teil eine „gemalte Autobiografie des Schmerzes“ darstellt. Der „verletzte Hirsch“ entstand 1946, nach einer Operation, die wieder einmal keine Besserung gebracht hatte. Leiacker dagegen widmet das Bild flugs um in „ein Sinnbild für die gestörte Mann-Frau-Beziehung, die auf Eroberung im Sinne von Töten aus ist“ [so ein Krampf! mit Verlaub], in ein Symbol für „den Beziehungskampf mit ihrem Ehemann“ (und ignoriert dabei souverän, dass gerade Frida Kahlo eine – nicht nur für das Mexiko der 40er Jahre – ausgesprochen emanzipierte Ehe geführt hat).
Nun also: kaum ist die Bestie Mann im Haus der Schönen, schon bringt er das ordentlich-saubere Regal in Unordnung; und natürlich dauert es dann auch nicht mehr lange bis zur Vergewaltigung …
Der Rest der Aufführung hangelt sich entlang der Einfälle Konwitschnys, meist weit weg vom Libretto, mal absurd abweichend (wo der katholische Cortez dem heidnischen Aztekenkaiser Kreuz und Madonna vor die Nase setzt, da kommt Konwitschnys Macho im roten Sportwagen angebraust), manchmal zumindest in einem assoziativen Zusammenhang (anstelle der „Gastgeschenke“ aus Gold und prächtigen Quetzalfedern lässt die Salzburger Montezuma ein halbes Dutzend nur mit ein bisschen Goldflitter bekleidete Mädchen auftreten und erinnert damit wenigstens ein bisschen an Malinche, die indianische Dolmetscherin und Konkubine Cortez‘). Und nur ganz selten findet man ein Szene so passend, wie die, in der Angela Denoke durch die Sitzreihen hastet und das schmuckbehangene Publikum mit Montezumas Vorwurf an die goldgierigen Eroberer konfrontiert:
Als die vielfach malträtierte Salzburger Frau (ich tu mich einfach schwer, die 'Montezuma' zu nennen) endlich – unter tätiger Mitwirkung fast des ganzen Ensembles – niederkommt, wird da nicht etwa ein europäisch-amerikanisches Mischlingskind geboren, kein Bastard aus Schöner und Biest … oder etwa doch? Das Ergebnis dieses Geburtsvorgangs ist ein Haufen Elektronikspielzeug. Ab da findet der Krieg im Wohnzimmer statt – als Computerspiel.
Aber hofft nicht zu früh – der Sopran wird dann doch ermordet; der Bariton verliert schließlich trotzdem seine Existenz. Ihren Geistern bleibt nur noch Octavio Paz‘ Liebesgedicht:
„Unter der nackten und lichten Liebe, die tanzt,
gibt es eine andere, schwarze Liebe, schweigsam und drohend,
Liebe einer Wunde im Verborgenen.
Die Worte gelangen nicht an ihren unsagbaren Abgrund,
ewige Liebe, starr und schrecklich …
Unter diesem Tod, Liebe, glückhaft und stumm,
gibt es keine Adern, keine Haut, kein Blut,
sondern nur den einsamen Tod;
tobende Stille,
ewig, umrisslos,
unerschöpfliche Liebe, der Tod entströmt.“
„Die Eroberung von Mexico“
Musiktheater nach Antonin Artaud
Libretto und Musik von Wolfgang Rihm
Salzburger Festspiele 2015
Musikalische Leitung: Ingo Metzmacher
Regie: Peter Konwitschny
Ausstattung: Johannes Leiacker
Licht: Manfred Voss
Video: FETTFILM
Dramaturgie: Bettina Bartz
Montezuma: Angela Denoke
Cortez: Bo Skovhus
Sopran: Susanna Andersson
Alt: Marie-Ange Todorovitch
Sprecher: Stephan Rehm, Peter Pruchniewitz
Malinche: Larissa Enzi, Luisa Sophie Fischer,
Anna-Eva Köck, Anna Königshofer,
Silvana Veit, Adele Vorauer