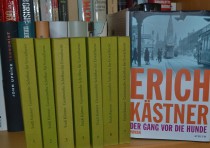Ein Schiller voller Mätzchen
Ideenreiche „Räuber“ in Bielefeld
g.WaSa - Bielefeld. - Wer mit dem Reclam-„Räuber“-Text im Hinterkopf zur Saison-Eröffnungs-Premiere ins Bielefelder „Große Haus“ kam, der musste die eine oder andere Enttäuschung erleben. Um mit dem Schlusssatz anzufangen: Das wohl bekannteste Zitat – „Dem Mann kann geholfen werden“ – ist einfach gestrichen! Und mit diesem „Mann“, „einem armen Schelm“, einem Taglöhner mit elf Kindern, ist auch ein Stück Sozialkritik gestrichen – nicht das einzige.
Denn natürlich ist der Text stark gekürzt – aber das geht ja nicht anders, bei diesem (stellenweise doch sehr weitschweifigen!) Drama. Größtenteils ist das auch ganz geschickt gemacht; nur das Robin-Hood-mäßige an Karl Moors Räubereien kommt etwas zu kurz; so vermisst man den Bericht des – ganz gestrichenen – Kosinsky, der in seiner Anklage absolutistischer Fürstenherrlichkeit Moors Kampf nachträglich als Feldzug gegen Tyrannenwillkür rechtfertigen könnte.
Kein berühmter Schlusssatz also. Stattdessen will Karl Moor wissen: „Seid ihr zufrieden?“ Wieder und wieder, wie schon mehrfach an diesem Abend, brüllt sie diese Frage ihren Spießgesellen entgegen - oder dem Publikum?
Gender-Mätzchen
„Sie“? – Ja, sie! Karl Moor wird von Isabell Giebeler gespielt (und gut gespielt!), und Amalia (ebenso gut!) von Jakob Walser. Warum? Tja, warum? Weil Gender-Swapping zur Zeit eine Mode auf den Bühnen ist? Wenn das Deutsche Theater in Berlin demnächst die Powerfrau Clavigo auf die Bühne stellt, die einen schlaffen Jüngling namens Marie sitzen lässt, dann steht da ein klares und sehr gut nachvollziehbares Konzept dahinter (ungeachtet aller Mängel der Inszenierung – s. Kritik der Voraufführung in Salzburg) – ein Konzept, das in Bielefeld nicht zu erkennen, geschweige denn nachzuvollziehen ist. Da wird einfach ein Schauspieler in Frauenkleider gesteckt und umgekehrt. Soll das die Befreiung des „wundervoll angelegten Charakters Amalia aus der Schnürbrust der Konventionen von 1776“ (Regisseur Tim Tonndorf) sein? Das Ergebnis ist eher verwirrend: wenn das zarte Persönchen Isabell (Entschuldigung – aber so wirkt sie nun mal zwischen all den Räubern) als Macho-Hauptmann auftritt und dann auch noch x-mal wiederholt „ein Weib [=Jakob-Amalia] erschüttert meine Mannheit nicht“. Also – Conchita-Wurst-Prinzip als modisches Mätzchen? (Wie so ähnlich bereits in der Bielefelder „Ratten“-Inszenierung?)
Franz - ein Opfer der Familie?
Mätzchen? – Dabei hatte es doch im Vorfeld so ausgesehen, als stünden große Ideen hinter Tonndorfs Inszenierung! Man mochte sich eine Neu-Charakterisierung des Franz erhoffen, eine Erklärung seines schurkischen Verhaltens aus der Familiengeschichte: „Schon lange lag etwas im Argen, in der Familie Moor“, hieß es vielversprechend in der Ankündigung; und vielversprechend ist auch der Beginn: die erste Konfrontation mit dem alten Moor, dem rechthaberisch-patriarchalischen Vater (mal wieder eine Paraderolle für Thomas Wolff), und zuvor noch der erste Monolog, in dem sich Franz (sehr glaubwürdig: Janco Lamprecht) als getriebene Persönlichkeit präsentiert, als ein vom grausamen Schicksal, vom ungerechten Vater ständig Benachteiligter, der doch auch nur an sein Recht auf ein bisschen Glück glaubt. Das war’s dann aber auch schon mit der Familiengeschichte …
Oder?
In einem Video-Vorspann treten neben Vater Moor drei Kinder auf. Man weiß nicht, wer sie sind, kann aber vermuten: Karl, Franz und … Amalia (die laut Schiller als verwandte Waise im Haushalt mit aufwuchs); laut Bielefelder Personenverzeichnis ist die Dritte aber Hermann, von Schiller einfach als „Bastard eines Edelmanns“ eingeführt, aber schon immer im Verdacht, „illegitimer“ Sohn des alten Moor zu sein. Welche Funktion hat Hermann in dieser Inszenierung? Dass er von Carmen Priego gespielt wird, schien mir nebensächlich (Hermann könnte leicht auch eine Hermine sein). Erstaunlich dagegen, dass er mal „Hermann Stein“ genannt wird (wenn ich das akustisch richtig verstanden habe). Dies bleibt so rätselhaft, wie der ganze Video-Vorspann (warum bekommen zwei – welche? – der Kinder vom Vater ein Goldfischglas?) - So rätselhaft wie übrigens auch weitere Videoeinspielungen (die oft schlicht an Unverständlichkeit aufgrund handwerklicher Mängel leiden – wegen undeutlicher Artikulation, oder weil sie auf einen ungeeigneten Hintergrund projiziert werden).
Freiheit rum-ta-ta
Vage bleibt auch die Idee von den „Räubern“ als „Drama der Freiheit“ (Dramaturgin Franziska Betz). Natürlich liegt der Gedanke an Freiheit bei Schiller immer nahe – aber welche Rolle spielt die Freiheit tatsächlich in den „Räubern“, zumal die „Gedankenfreiheit“, die Tonndorf flugs aus dem „Carlos“ herbeizitiert? Wem geht es da wirklich um Freiheit? Franz will Macht; Amalia will Liebe; Karl will seine Frustration über den grausamen Vater in Gewalt umsetzen. Und die Räuber? Schiller selbst macht aus den „Libertinern“ ganz schnell ordinäre „Banditen“! Die Proklamation der Freiheit gerät in dieser Inszenierung schließlich zur Peinlichkeit: Tonndorf läßt Spiegelberg („die freieste Figur im Stück“; ansonsten beeindruckend: Georg Böhm) sich ans Publikum wenden („alle mitsingen!“) und einen Text von Müller-Westernhagen sülzen, in dem neben dem mehrfach wiederholten Wort „Freiheit“ vor allem ausgesprochener Schwachsinn steht („Die Kapelle, rum-ta-ta. Und der Papst war auch schon da …“).
Affen-Mätzchen
Oder soll es etwas über „Freiheit“ aussagen, wenn die Kumpane Karl Moors, die sich als ursprüngliche „Libertiner“ im Dunstkreis eines Coca-Cola-Automaten versammelt hatten, dann, wenn sie sich als „Banditen“ in die böhmischen Wälder zurückziehen, zu einer Horde von Affen mutieren („Wir sind das Volk“)? Die Bühne wird ab hier konsequenterweise zu einem Affenkäfig, wie wir ihn aus dem Zoo kennen. Den Schauspielern (Stefan Imholz, Sebastian Graf und Niklas Herzberg als Schweizer / Roller / Razmann) ist immerhin zugute zu halten, dass sie offenbar äffisches Verhalten genau studiert haben …
Aber was soll‘s? Die Räuber als Affen? Große Idee oder albernes Mätzchen?
Regie-Einfälle: rätselhaft bis tragi-komisch
Wer vieles bringt, wird jedem etwas bringen: Neben „Mätzchen“ auch so manche hübsche Idee: mal lokalpatriotisch (ein Räuber-Überfall ereignet sich auf dem „Alten Markt“, dem Platz in Bielefeld, an dem die Dependance des Theaters steht), mal rätselhaft (Carmen Priego steht als Pastorin Moser am Ende ihres theologischen Diskurses in einem roten Flammengewand da – ein Höllenengel?), mal tragi-komisch: die sich im 5. Akt häufenden Toten verabschieden sich aus dem Leben, indem sie sich eine Flasche Ketschup ins Gesicht schmieren (so wirkte es aus der 7. Reihe – womöglich war’s ja auch handelsübliches Theaterblut). Da sieht man dann auch darüber weg, dass bei den ganzen Morden und Selbstmorden einiges an Täter-Opfer-Beziehungen durcheinander geraten ist (was Tonndorf vorab damit rechtfertigt, dass schließlich auch Schiller verschiedene Schlussversionen durchprobiert habe). Der dramaturgische Sinn ???
Großer Schiller!
Allerdings: Man sollte über die Mätzchen hinwegsehen, kann die sich aufdrängenden Fragen ignorieren. Dann bleibt ein großes Drama! Eine ans Herz rührende Tragödie. Kurz: ein echter Schiller! Trotz der eingangs beklagten Kürzungen.
Und ehrlich: der junge Schiller treibt es manchmal arg weit mit seiner dramatischen Rhetorik, mit seinem überschäumenden Pathos. Da ergibt sich eine wundervoll-angenehme Mischung, wenn auf der Bielefelder Bühne der „Rausch der Schillerschen Sprache“ (Tonndorf) immer mal wieder mit nüchternen Elementen gedämpft wird. Mal sind das einfache Übersetzungen von (nicht mehr gebräuchlichen) Fremdwörtern: wo Schiller „Antezessor“ schrieb, da spricht der Bielefelder Roller einfach von seinem „Vorgänger“ am Galgen. Mal ist ein Shakespeare-Zitat in den Text geschmuggelt („Meine Thans verlassen mich“ – aber vielleicht habe ich mich da auch verhört, denn anders als bei Macbeth passt die Aussage hier inhaltlich nicht; und – wie bereits angedeutet -: oft wünscht man sich, Tonndorf hätte seine Schauspieler lieber zum deutlichen Formulieren anstatt zum hastigen Sprechen angehalten).
Vor allem der famose Spiegelberg darf immer wieder aus dem schillerschen Sprachrahmen fallen ("das steht mir bis Oberkante Unterlippe"). Sein Bericht über die Rekrutierung neuer Räuber wird zum Kabinettstückchen populistischen Demagogen-Sprechs. Neben einer Sammlung hochtrabender Gemeinplätze (von "Stellt euch vor, es ist Krieg, und keiner geht hin" bis "Wenn der letzte Baum gefällt ist ...") finden sich auch ein paar (mir bisher unbekannte) wunderbare Aphorismen: "Die Political Correctness liegt wie Mehltau über unserem Land" oder "Unterhaltung dient dem unten halten" ....
Für letzteres mag diese Inszenierung – hoffentlich! – als Gegenbeispiel dienen: Ja, sie bot Unterhaltung, gute Unterhaltung (dem begeisterten Premierenapplaus nach zu urteilen), aber: wer denn mag, findet in ihr auch reichlich Stoff zum Nachdenken. Was will man mehr?
Theater Bielefeld:
Die Räuber
von Friedrich Schiller
Inszenierung: Tim Tonndorf (Prinzip Gonzo)
Bühne: Anna Bergmann
Kostüme: Josephin Thomas
Musik und Video: Robert Hartmann (Prinzip Gonzo)
Dramaturgie: Franziska Betz
Maximilien / Pater: Thomas Wolff
Karl: Isabell Giebeler
Franz: Janco Lamprecht
Amalia von Edelreich: Jakob Walser
Spiegelberg: Georg Böhm
Schweizer: Stefan Imholz
Roller: Sebastian Graf
Razmann: Niklas Herzberg
Hermann / Pastor Moser: Carmen Priego
Nächste Aufführungen:
|
Sa. 12.09.2015 um 19:30 Uhr |
|
|
So. 20.09.2015 um 19:30 Uhr |
|
|
Mi. 23.09.2015 um 20:00 Uhr Einführung jeweils 30 Minuten vor Beginn im Loft |
|