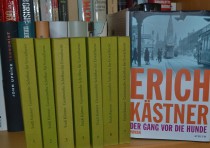„Die Orchesterprobe“: Wüstes Spektakel zur Saisoneröffnung
Michael Heicks beleuchtet den Zustand unserer (?) Demokratie
(Mehr Fotos: www.kulturinfo-lippe.de)
(WaSa) Mit einem wüsten Spektakel beginnt Intendant und Regisseur Michael Heicks die neue Spielzeit des Theaters Bielefeld: mit der „Orchesterprobe“ nach einem Fellini-Film. In der „vorgeführten“ zusammengewürfelten Truppe weht nicht der hehre Geist (klassischer) Musik. Hier herrscht das Gesetz des Dschungels: catch as catch can, jeder gegen jede und alle gegen den Dirigenten. Von wegen kultivierte Gespräche – angesagt sind ruppige Töne, eine obszöne, unflätige Sprache. Der Dirigent zeigt seinen Musikern und dem Publikum den Hintern (in Fellinis Film hat er dabei wenigstens die Hose oben gelassen). Da ist es nur konsequent (und gerecht), dass am Schluss der ganze Konzertsaal / Probenraum zusammenbricht. Kann man abhaken!
Oder?
Natürlich wollte Fellini nicht einfach ein paar Chaoten filmen; sein Film war – anno 1979 - gedacht als Allegorie auf „das Chaos der italienischen Gesellschaft und die Unfähigkeit deren Politik“ (Wikipedia). Und so ist auch die Bielefelder „Orchesterprobe“ nicht einfach ein Rüpelstück in der ehrenhaften Tradition Shakespeares; vielmehr will auch Heicks, nunmehr für die Zeit des Finanzkapitalismus, „die gesellschaftliche Allegorie, die ... die inneren Widersprüche des demokratischen Systems als einer Gemeinschaft von Einzelnen thematisiert“ auf seine Bühne bringen, mit „dem grundlegenden Konflikt zwischen dem Individuellen und dem Kollektiven“.
Wer sich auf diese Interpretation einlässt, erlebt eine frappante Inszenierung. Das beginnt mit dem (Staats-)Gebäude: einem Konzertsaal, der erheblich bessere Tage gesehen hat (ehemalige Kirche mit weltbekannter Akustik), wo aber irritierende Tropfgeräusche nerven, da heute (anders als bei Fellini) der Regen von Anfang an durch die Decke tropft. In dieses heruntergekommene Ambiente passen die Musiker(innen), die allmählich eintrudeln (oder auch nicht) und sich erst mal produzieren (und damit die anderen herabsetzen) müssen. Zusammenspiel? Aber doch nicht mit uns! Erst in der Pause, als (fast) alle an der Rampe sitzen und Spaghetti mampfen, bricht sich die italienische Sentimentalität Bahn: gemeinsam wird die italienische „Nationalhymne der Herzen“ angestimmt – eine bewegende, anrührende Szene. Nur – man sollte sich bewusst sein, dass es sich dabei um einen Chor von Gefangenen (!) (aus Verdis Nabucco) handelt! Das Gemeinschaftsgefühl endet denn auch abrupt, als wieder die persönlichen Probleme Einzelner in den Vordergrund treten. Immerhin kommt es dann doch zur gemeinsamen Aktion, zum Versuch, aus der Gefangenschaft des Kollektivs auszubrechen: Revolution! „Wir brauchen keinen Dirigenten mehr! Wir brauchen keine Musik mehr! Wir brauchen gar nichts mehr!“
Es folgt der Crash: Der Konzertsaal bricht zusammen (wenn uns auch Fellinis gigantische Abrissbirne vorenthalten wird); die Trümmer begraben die Harfenistin unter sich. Den dadurch ausgelösten Schock nutzt der Dirigent. Nach dem Motto „Alles hört auf mein Kommando“ führt er die Probe fort. Mit der Parole „Ich will den totalen Ton!“ endet das Stück. - La Commedia continua!
Tatsächlich – eine hervorragend gelungende Parodie auf gegenwärtige Wirklichkeit! Bei der gescheiterten Revolution mag man an die Occupy-Bewegung denken, die gegen das Dirigat des Finanzkapitals aufzumucken versuchte. Doch wo sind heute die „99 Prozent“ geblieben? Sie gehen weiterhin zur Arbeit und vertrauen ihr Geld den Banken an. Und wenn es tatsächlich gelänge, das Primat der Politik über das Kapital wieder (?) herzustellen – wäre damit wirklich mehr gewonnen als mit dem Versuch des Orchesters, den Dirigenten durch ein riesenhaftes Metronom zu ersetzen?
Das Manko der Inszenierung: Sie ist zu lang, viel zu lang. Zugegeben: Heicks bringt viel darin unter, gelegentlich mehr als Fellini in seinem Film (köstlich beispielsweise: die parodistisch überzeichneten Orchesterbewegungen beim „Galopp“). Aber es dauert einfach zu lang, bis jede und jeder dargetan hat, dass SEIN/IHR Instrument nun mal das wichtigste (und nebenbei: schwierigste) sei. Dabei ist jedem einzelnen der 18 (!) Darsteller sein Auftritt zu gönnen, eigentlich möchte man keinen missen: nicht den arrogant-divenhaften John Wesley Zielmann (1. Geige), nicht den Looser Omar El-Saeidi (Trompete), schon gar nicht die lispelnde Carmen Priego mit ihrer Simpson-Frisur, ihrem verspäteten aber grandios inszenierten Auftritt und ihrem grotesk überzeichneten Sabine-Meyer-Gewackel beim Oboen-Spiel. Und so weiter, bis hin zum latin-lover-haften Dirigenten (Sefan Imholz) und zum zwielichtig-geschäftstüchtigen Orchesterwart Helmut Westhausser, der sich mit dem senilen Alt-68er Jan Kämmerer (Cello) einig ist, dass früher alles besser war.
Aber in der Summe wirkt das ermüdend. Fellinis Film dauert 70 Minuten. Heicks benötigt zwei Stunden für seine Inszenierung.