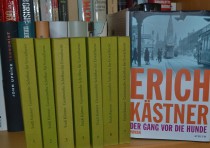Mutter-Tragödie – Theater-Komödie – Inszenierungs-Zumutung
Textpotpourri unter dem Titel „Ratten“ am Bielefelder TAM
g.WaSa - Bielefeld. Eine erkleckliche Anzahl von Zuschauern hatte das Bielefelder Theater am Alten Markt während der Pause verlassen. Ich selbst habe das – bei wohl 1000 und ein paar Theaterbesuchen – erst ein einziges Mal gemacht. Doch jetzt, kurz nach Beginn der zweiten Hälfte von Sébastien Jacobis Version von Hauptmanns „Ratten“ wird der Drang immer größer, einfach zu gehen. Ich weiß nicht, war es Pflichtbewusstsein, das mich bleiben ließ (immerhin: einen – sicherlich moderateren - Verriss hätte ich schon nach der ersten Hälfte schreiben können) oder einfach die Rücksicht auf die andern in meiner Reihe, die dann hätten aufstehen müssen.
Mann wird Weib und Weib wird Mann
Die Irritation beginnt beim Lesen des Personenverzeichnisses: Pastor Spitta wird von Carmen Priego verkörpert; dazu kommen wir noch. Dass Alice Rütterbusch, das Wiener Gspusi des Theaterdirektors Hassenreuter, von Janco Lamprecht gespielt wird, findet man noch ganz witzig – warum soll sich der konservativ-wohlanständige Spießbürger nicht ein schwules Verhältnis gönnen?! Ganz nett auch, dass Alice sich mit einem typischen Wiener Couplet vorstellt, mit dem (beifällig?) belachten Refrain: „Was nützt mir denn das viele Geld – in Bielefeld?“ Aber dass die/der Geliebte dann wie selbstverständlich die Rolle der Mutter von Hassenreuters Tochter einnimmt – das passt einfach nicht mehr. Das zeugt von schlampigem Umgang mit dem Text!
< < < < < > > > > >
Zugegeben: ich zähle mich zu den überzeugten Anhängern des „Regietheaters“, womit ich vor allem meine: anhand eines (alten) Stückes gegenwärtige Fragen zu erörtern. - Und zugegeben: Gerhart Hauptmann hat in seine „Berliner Tragikomödie“ von 1909/1910 so viel hineingepackt, dass eine Inszenierung „aus einem Guss“ gerade dann schwierig wird, wenn man das Stück „aktualisieren“ (um es mal stark vereinfacht so zu nennen) will:
Die Mutter-Tragödie
Da ist zunächst einmal die Tragödie der „Mutter (!) John“, dem kinderlosen „Muttertier“, das dem ledigen Dienstmädchen Pauline sein Neugeborenes abnimmt, für das eigene ausgibt und keine Mittel scheut, eine Rückgabe des Kindes zu verhindern – mit dem Ergebnis, dass eine leidlich funktionierende Ehe zerbricht und am Ende nicht nur die unglückliche leibliche Mutter tot daliegt, sondern auch die Pflegemutter. Und auch das Schicksal des Kindes ist vorgezeichnet: es kommt in eine dubiose Pflege, und da „sterben von’s Dutzend mehrschtens zehn.“ – Eigentlich eine zeitlose Geschichte, die deshalb auch einigermaßen so auf die Bühne kommt, wie Hauptmann sie geschrieben hat – auch einer der besten Regie-Gags findet sich in diesem Umfeld: Wenn der falsche aber dennoch glückliche Vater Paul John seinen Kumpels zum freudigen Ereignis „ne Lage jibt“, dann heißen die nicht Fritze und Karl, sondern „George und Ringo“.
Die Theater-Komödie – und der tiefe Griff in die Aktualisierungs-Kiste
Dem proletarisch-kleinbürgerlichen Milieu der Familie John stellt Hauptmann die Welt des bildungsprotzigen Theaterdirektors Hassenreuter gegenüber, der im Dachgeschoss über der Johnschen Wohnung seinen riesigen Fundus eingelagert hat. Er hat (warum auch immer) seinen Direktorenposten in Straßburg verloren und schlägt sich jetzt durch, indem er Kostüme verleiht und indem er mehr oder weniger begabten Theateradepten Schauspielunterricht erteilt – unter anderen dem abgebrochenen Theologiestudenten Spitta, mit dem er sich einen unendlichen Grundsatzstreit liefert: während der alte Direktor noch „der Schiller-Goethisch-Weimarischen Schule der Unnatur“ anhängt, propagiert der junge Theater-Erneuerer das moderne naturalistische Theater – und damit die Position des jungen Hauptmann (der übrigens tatsächlich Unterricht bei einem ehemaligen Straßburger Theaterdirektor Heßler mit Kostümfundus in einer Berliner Kaserne genommen hatte).
Aus dem Fundus haben es lediglich ein Pappenheimscher Helm und ein Brustharnisch auf die Bielefelder Bühne geschafft. Und anstatt mit seinen Schülern – wie von Hauptmann vorgegeben – Schillers „Braut von Messina“ zu proben, lässt der Bielefelder Hassenreuter sie den „Taucher“ deklamieren. Warum? Okay – warum nicht? Immerhin: wer heutzutage noch Schiller-Balladen kennt, mag sich darüber amüsieren, dass Wallburga den Streit zwischen Papa Hassenreuter und ihrem Verehrer Spitta mit den Worten zu schlichten sucht: "Laßt, Vater, genug sein das grausame Spiel!“
Wenn man’s dabei doch belassen hätte! Doch jetzt greift Jacobi gaaanz tief in seine Aktualisierungs-Kiste! Zunächst zitiert Spitta den jung-revolutionären Dichter Trepljow aus Tschechows „Möwe“: „Wir brauchen neue Formen!“, um Hassenreuter zu beeindrucken (als ob sich ein Weimarianer von Tschechow beeindrucken ließe!); dann lässt er – wie in der „Möwe“ – ein Stück im Stück aufführen, das bei Hassenreuter auf ebensowenig Gegenliebe stößt wie Trepljows Experiment bei Tschechows konservativer Landgut-Bohème. (Angeblich soll „Spittas Stück“ im Internet stehen, wo ich’s aber – unter einem halben Dutzend Schreibvarianten – nicht gefunden habe). Und jetzt muss Spitta zu ganz großer Form auflaufen: er traktiert uns mit einer absolut nicht endenwollenden Anleitung zur Erstellung postdramatisch-nichttheatralischer Theaterstücke! Nun, wenigstens lässt sich das mit dem radikal-aktualisierten Rollenbild des jungen Theater-Revoluzzer Spitta vereinbaren. Aber dann darf auch noch Hassenreuter – ausgerechnet der konservative Hassenreuter – eine Kunsttheorie herausposaunen, die aus (beliebigen?) Zitatsplittern von Carl Hegemann, Jonathan Meese und und und ... zusammengestückelt ist.
Dann ist – nach langen ein-ein-halb Stunden – endlich Pause.
Dämonen der Großstadt und urbanes Inferno
Nach der Pause zerfasert der Rest des Stückes vollends. Die Darsteller äußern sich zunehmend durch Geschrei – in Verbindung mit heftigem Dialekt und eiligem Sprechtempo schadet das der Verständlichkeit. Erst recht, wenn Nebengeräusche (z. B. durch das Malträtieren eines Klaviers) zusätzlich stören.
Über die Mutter-Tragödie und die Theater-Komödie hinaus hatte Hauptmann noch ein weiteres Anliegen an die „Ratten“, das er im Tagebuch so formulierte: „Vielleicht kann ich dieser Stadt einmal den Spiegel vorhalten“; er sah Berlin: „erfüllt von Dämonen, ein Inferno“. Konkretisiert hat Hauptmann das zum einen in dem kriminellen Milieu um Frau Johns Bruder Bruno sowie der singfreudigen Gangster-Familie im Hinterhaus. Außerdem in dem elenden Schicksal sogenannter „lediger Mütter“, von denen in den „Ratten“ gleich drei eine Rolle spielen – ein in wilhelminischer Zeit (und bis weit in die Weimarer Republik hinein; vgl. z. B. Wolfs „Cyankali“ von 1929) offenbar virulentes Thema. Doch heute? Als 2011 im nahen Detmold die „Ratten“ im Theater liefen, war durch einen aufsehenerregenden „Ehrenmord“ die Geschichte der verstoßenen Tochter plötzlich wieder ganz präsent (à „Zeitloser Verfall“). Doch das ist auch schon wieder ein paar Jahre her.
Was also tun, um die unbedingt gewollte Aktualisierung auf die TAM-Bühne zu kriegen?
Eine Schlüsselfigur ist der Landpfarrer Spitta, der Vater des Schauspielschülers, der selbst einmal – „triefend von Christentum“ – eine „gefallene“ Tochter ins Elend gestoßen hat, der jetzt eigens nach Berlin kommt, um den Sohn von der unehrenhaften Theaterlaufbahn abzuhalten, und der nebenbei die Großstadt-Dämonie in Worte fasst: „Dieses Sodom Berlin ... die anstößigsten Nuditäten ... die aufgedonnerte Sünde ... einfach Weltuntergang!“
Nun, diesem selbstgerecht-bigotten Untergangpropheten wird nicht nur – mit der weiblichen Besetzung – seine Geschlechtsidentität geraubt, ihm wird auch sein kompletter Original-Text weggenommen. Stattdessen sitzt die wunderbare Schauspielerin Carmen Priego, anstatt wunderbar zu schauspielern, nach der Pause in einer Ecke und rattert so eine Art (muss man es erwähnen: eeendloooose) Zivilisationskritik herunter, die vermutlich ebenso zusammengestückelt ist wie Hassenreuters Kunsttheorie. – Normalerweise ist es mir nach dem Theaterbesuch ein zusätzliches Vergnügen, die Herkunft von Einschüben zu recherchieren – aber da ich bereits drei Stunden (und damit MINDESTENS eine zuviel) meiner Lebenszeit in der Aufführung verbracht habe, will ich damit nicht auch noch Zeit vergeuden – stattdessen eine (zugegeben: polemische) Vermutung: Es hört sich so an, als sei eine Klasse von Soziologie-Studenten zu Studienbeginn aufgefordert worden, Gedanken zur Zeit zu formulieren, und als habe jemand daraus beliebige Sätze herausgeklaubt. Wenn man mir sagt, dass die Texte von Soziologie-Professoren stammen, dann glaube ich es – das beweist aber nur, dass man die Ergüsse von (manchen) Professoren nicht von denen ihrer Erstsemester unterscheiden kann.
So weit, so schlecht. Da aber mit all dem die drei erwähnten Stunden immer noch nicht gefüllt sind, darf Pastor Priego noch Gedichte vortragen, die zumindest insofern mit dem Stück zu tun haben, als sie von Hauptmann stammen („Ich bin Papier, du bist Papier ... so ruhen Herz an Herzen wir ... und 2 x 2 ist nicht mehr 4 ...“. Und dazu spielt dann ein Klavier.). Andere singen – teils recht unbeholfen – irgendwelche Songs, und dann tritt auch noch ein einigermaßen grauslicher Chor auf, der entweder stumm rumsteht oder TonSteineScherben-Lieder singt („Bleib wo du bist“) und als Höhepunkt eine Gutmenschen-Version der Nationalhymne:
„Anmut sparet nicht noch Mühe
Leidenschaft nicht noch Verstand
Daß ein gutes Deutschland blühe
Wie ein andres gutes Land“ – Ach ja! Der gute alte Brecht!
Die gute alte Kästner-Frage
Wo bleibt das Positive?, frage ich mich immer, wenn ich allzu viel herumgemeckert habe. Meistens finde ich dann noch ein sehr wohl berechtigtes Lob für den einen oder andern Schauspieler. Könnte man auch hier (Lukas Grasers/Hassenreuters köstlich-resignierte Mimik während Anton Plevas/Spitta-Juniors Vortrag zum Beispiel). Oder das – ebenfalls von Jacobi verantwortete – durchaus ansprechende Bühnenbild. Aber, um mal wieder Brecht zu paraphrasieren: Was nützt der wohlgeformte, schön bemalte Krug, wenn darin nur fauliges Wasser ist?
Ein Lob ist mir dann doch ein Anliegen: Das Personal im Lorca, der gemütlichen TAM-Kneipe, war bemerkenswert freundlich. (Ehrlich: schon vor Beginn des Stücks, als ich noch nicht wusste, was mir da bevorsteht, hab‘ ich gedacht, das müsste man ja auch mal erwähnen).
Vielleicht hätte ich nach der Pause doch lieber noch einen Rotwein trinken sollen?
Theater Bielefeld – Theater am Alten Markt (TAM)
Die Ratten
Berliner Tragikomödie von Gerhart Hauptmann
Inszenierung und Bühne: Sébastien Jacobi
Kostüme: Nehle Balkhausen
Musik: Christoph Iacono
Dramaturgie: Katrin Enders
Harro Hassenreuter, Theaterdirektor: Lukas Graser
Walburga, seine Tochter: Felicia Spielberger
Pastor Spitta: Carmen Priego
Erich Spitta, sein Sohn: Anton Pleva
Alice Rütterbusch, Schauspieler(in): Janco Lamprecht
Käferstein, Schauspielschüler: Christoph Iacono
John, Maurerpolier: Thomas Wehling
Frau John: Doreen Nixdorf
Bruno Mechelke, ihr Bruder: Georg Böhm
Pauline Piperkarcka, Dienstmädchen: Judith Patzelt
Frau Sidonie Knobbe: Nicole Lippold
Selma, ihre Tochter: Isabell Giebeler
Weitere Termine:
Do. 16.04.2015 20:00 Uhr
Fr. 17.04.2015 20:00 Uhr
Di. 30.06.2015 20:00 Uhr
Mi. 01.07.2015 20:00 Uhr
Do. 02.07.2015 20:00 Uhr